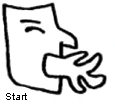


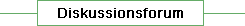
Zurück zum Forenbereich
»Übrigens ...«
Beiträge zum Thema »Sonstige Nachrichten«
Neueste Beiträge zuoberst anzeigen | nach unten
|
Jan-Martin Wagner Jena |
Dieser Beitrag wurde am 29.01.2006 um 13.41 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#503 »Taugt Wikipedia zur Literaturenzyklopädie? Trotz Einschränkungen halten Experten das freie Lexikon für verlässlich« Artikel in der „Berliner Literaturkritik“ vom 24. 1. 2006. Auszug: »Das „Wiki-Prinzip“ hält auch der Erlanger Germanist Gunther Witting für „bestechend“. Witting ist Urheber der Erlanger Liste, die in Germanistenkreisen Kultstatus genießt. Für viele Studenten ist die umfangreiche Linksammlung der erste Anlaufpunkt internetbasierter Recherche. Seinen Studenten kann Witting auch Wikipedia ohne schlechtes Gewissen empfehlen. Er sieht keine gravierenden Unterschiede zu den etablierten literarischen Nachschlagewerken. „Ich vermute, dass die Fehlerquote bei der Wikipedia kaum höher sein dürfte“, sagt Witting. „Aber natürlich gibt es bessere Lexika – etwa das (neue) Reallexikon der Literaturwissenschaft, das freilich für Studenten kaum zu bezahlen ist.“ Richtig grobe Schnitzer seien ihm bei Wikipedia zwar noch nicht aufgefallen, dafür existiere im Bereich literaturwissenschaftlicher Fachbeiträge durchaus noch Nachholbedarf. Hier sei der Anteil „dürftiger Artikel“ noch relativ hoch.« (Es gibt auch zwei Absätze zur Rechtschreibung, aber die sind eher uninteressant.) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Jena |
Dieser Beitrag wurde am 23.05.2006 um 19.54 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#686 International gefragte Sprachberatung an der TU Chemnitz ist nun auch online Der wandelnde Duden Sprachberatung an der TU Chemnitz: Dr. Ruth Geier bietet den international gefragten Service jetzt auch im Internet an In den vergangenen zehn Jahren wurde wohl kaum ein amtliches Regelwerk so oft reformiert wie die deutsche Rechtschreibung. Wer weiß da eigentlich noch, ob das "Du" in Briefen nun doch wieder groß oder das "s" und "t" bei der Worttrennung zusammen oder getrennt geschrieben werden müssen? Antworten auf diese Fragen gibt Dr. Ruth Geier, Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Professur Medienkommunikation der TU Chemnitz, jetzt auch im Internet unter http://www.sprachberatung.tu-chemnitz.de. Anfragen können ab sofort per E-Mail an sprachberatungen@tu-chemnitz.de gestellt werden. "Ein Grund für den Weg ins World Wide Web ist die große Resonanz auf die Chemnitzer Telefonberatung, unter anderem auch aus den Niederlanden und der Schweiz", erklärt Geier, die seit Juni 2002 auch das "Sprachberatungstelefon" an der TU Chemnitz anbietet. Das Team um die Chemnitzer Germanistin setzt sich aus Studierenden des Studiengangs Medienkommunikation zusammen. "Wir beraten zu Rechtschreib- und Grammatikfragen, gehen sprachlichen Phänomenen auf den Grund oder analysieren verwendete Ausdrücke in der Jugendsprache", erklärt die Sprachexpertin. Die Zielgruppe ist groß: Sekretärinnen, das Ordnungsamt oder verunsicherte Eltern, die die korrigierten Diktate ihrer Kinder anzweifeln, gehören zum Alltag. Anfragen zu Redewendungen wie "in trockenen Tüchern sein" oder veraltete Worte wie zum Beispiel "Ortonom", stellen aber auch Ruth Geier, die diese Arbeit ehrenamtlich macht, immer wieder vor neue Herausforderungen. So fand sie heraus, dass ein "Ortonom" eine verstümmelte Form von "Hortus", dem Garten, ist. Woher sie allerdings ihr Wissen nimmt, behandelt sie wie ein gutes Rezept - geheimnisvoll. "Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht", schmunzelt Geier. Nur so viel: Neben ihrer zehnjährigen Erfahrung als Sprachberaterin zieht sie viele Parallelen aus dem Lateinischen und Griechischen, einschlägigen Lexika und dem Grimmschen Wörterbuch, das bekannteste deutsche Wörterbuch. Weitere Informationen erteilt Dr. Ruth Geier, Sprachberaterin und Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Professur Medienkommunikation der TU Chemnitz, unter Telefon (01 77) 392 70 04 oder per E-Mail sprachberatungen@tu-chemnitz.de Weitere Informationen: http://www.sprachberatung.tu-chemnitz.de - Online-Sparchberatung an der TU Chemnitz (Informationsdienst Wissenschaft, 23. Mai 2006) |
| nach oben | |
|
Sigmar Salzburg Dänischenhagen |
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2006 um 08.14 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#751 Robert Gernhardt ist tot Aus „Siebenmal mein Körper“ Mein Körper ist voll Unvernunft, ist gierig, faul und geil. Tagtäglich geht er mehr kaputt, ich mach ihn wieder heil. Mein Körper kennt nicht Maß noch Dank, er tut mir manchmal weh. Ich trug ihn trotzdem übern Berg Und fahr ihn an den See. Mein Körper ist so unsozial. Ich rede, er bleibt stumm. Ich lebe ein Leben lang für ihn. Er bringt mich langsam um. Als letzte Zeitungsnotiz hatte ich vermerkt: Der Schriftsteller und Zeichner Robert Gernhardt, der am Montag in Düsseldorf den angesehenen Heine-Preis erhält, hadert heftig mit der Rechtschreibreform. "Wenn meine Gedichte in den Schulbüchern in der neuen Rechtschreibung erscheinen, dann habe ich das Gefühl, das ist nicht von mir", sagte der Satiriker am Sonntag in Düsseldorf. Er finde es "auch nicht in Ordnung, wie das in Gang gesetzt worden ist", meinte Gernhardt, … (APA/dpa 12.12.04) … noch aus von Robert Gernhardts Nonsensgedichten mit den unnachahmlichen Federskizzen, hier zu jeder Zeile eine Birne, deren winziger Mundfleck die Gemütsbewegung andeutet: Birnes Problem Herr Birne, sagt, warum so gram? Weil man mir meinen Stängel nahm! Er ist noch dran, Ihr Stängel – Ach ja? Sie sind ein Engel! Natürlich hat Gernhardt hier reimgerecht „Stengel" geschrieben, denn „Ängel" (wg. gr. angelos) und „Ältern" werden sich die Reformfuzzies nie trauen, weil ihnen sonst der Himmel auf den Kopf kommt – oder die Eltern! |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Jena |
Dieser Beitrag wurde am 13.07.2006 um 00.40 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#780 Juniorprofessur: Zukunft des Modells fraglich Hamburg (ots) - Die Juniorprofessur steht nur vier Jahre nach ihrer Einführung vor dem Scheitern. Das zeigt das Ergebnis einer bislang unveröffentlichten Studie des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE), die der ZEIT vorliegt. Die Juniorprofessur sollte wissenschaftliche Karrieren in Deutschland beschleunigen - so hatte die früheren Bildungsministerin Bulmahn gehofft. Wissenschaftler sollten bereits mit Anfang 30 eigenständig lehren und forschen können. Die Studie zeigt, dass seit 2002 nur 1000 Juniorprofessuren ausgeschrieben worden sind - das Bundesbildungsministerium war von 6000 Stellen ausgegangen. Besonders dramatisch: Seit 2004 hat sich die Zahl der Juniorprofessuren kaum erhöht. Schon vor zwei Jahren gab es zwischen 800 und 930 Stellen. Zuletzt wurden nur zehn Stellenangebote im Monat veröffentlicht. (news aktuell, 12. 7. 2006) Gesetz soll Perspektiven junger Forscher verbessern Hamburg (ots) - Die Bundesregierung plant ein neues Gesetz, das jungen Forschern künftig bessere Perspektiven eröffnen soll. Das berichtet DIE ZEIT in ihrem Internetangebot, ZEIT Online. Die Bildungsministerin Annette Schavan will nach Informationen von ZEIT Online die so genannte "12-Jahres-Regelung" lockern, die besagt, dass wissenschaftliche Mitarbeiter in ihrer Qualifikationsphase nur zweimal sechs Jahre befristet beschäftigt werden dürfen. Die "12-Jahres-Regelung" wurde 2002 von Schavans Vorgängerin Edelgard Bulmahn erlassen und sorgt seit Jahren für Zukunftsängste unter deutschen Nachwuchswissenschaftlern. Sie besagt, dass wissenschaftliche Mitarbeiter in ihrer Qualifikationsphase nur zweimal sechs Jahre befristet beschäftigt werden dürfen, jeweils vor und nach ihrer Promotion. Danach sollten sie eine feste Stelle, sprich Professur gefunden haben - oder sich außerhalb der Wissenschaft einen Job suchen. Schavans Gesetzesentwurf, der der ZEIT vorliegt, sieht nun vor, dass befristete Verträge auch nach den 12 Jahren abgeschlossen werden dürfen, wenn sie durch sogenannte Drittmittel finanziert werden. Ein Großteil der Wissenschaftler arbeiten bereits in solchen Drittmittelprojekten. In Zukunft sollen sie dies auch dann tun dürfen, wenn die 12-Jahresfrist verstrichen ist. Den vollständigen Text finden Sie unter: http://www.zeit.de/online/2006/28/forschung_anstellung?page=all (news aktuell, 12. 7. 2006) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Jena |
Dieser Beitrag wurde am 21.07.2006 um 17.58 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#802 Die „Welt“ bekommt neuen Chefredakteur Die Tageszeitung „Die Welt“ bekommt einen neuen Chefredakteur. Es ist Thomas Schmid, der Ressortchef Politik der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Schmid werde so bald wie möglich die Chefredaktion von Roger Köppel übernehmen, spätestens zum 1. Januar 2007, teilt der Axel Springer Verlag mit. Köppel kehrt als Herausgeber und Chefredakteur zur Schweizer „Weltwoche“ zurück. Er wird Mehrheitsaktionär der sich in Gründung befindenden Weltwoche Verlags AG. Köppel hatte die „Weltwoche“ als Chefredakteur bis vor zwei Jahren geführt und war dann zu Springer gewechselt. Thomas Schmid ist seit Gründung der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ Ressortchef Politik. Im September 2000 war er in die Politikredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eingetreten, zuvor war er seit 1998 Leiter des Meinungsressorts „Forum“ bei der „Welt“. Davor war Schmid für die „Wochenpost“ und die „Hamburger Morgenpost“ tätig. Angefangen hatte er in den Jahren 1979 bis 1986 als Lektor im Verlag Klaus Wagenbach. „Einmalige Herausforderung“ Schmid sei als Chefredakteur eine ideale Besetzung, sagte der Vorstandsvorsitzende von Springer, Mathias Döpfner. Roger Köppels Ausscheiden bedaure er sehr, Köppel habe den Modernisierungsprozeß der „Welt“ weiter vorangetrieben. Er habe aber Verständnis dafür, daß sich Köppel der „einmaligen Herausforderung, sich publizistisch und zugleich unternehmerisch zu engagieren, nicht widerstehen kann“. Der Modernisierungsprozeß der Zeitungsredaktionen bei Springer bringt es allerdings mit sich, daß die einzelnen Zeitungen stärker aneinander- und die Chefredakteure in eine Gesamtredaktion eingebunden werden. So sind vor einigen Wochen einige der zuvor eigenständigen Ressorts der „Welt“ und der „Welt am Sonntag“ zusammengelegt worden. Was nicht nur unter den Ressortchefs für Unruhe sorgte. Die Position des Chefredakteurs der „Welt am Sonntag“, Christoph Keese, erscheint durch diesen Prozeß eher gestärkt worden zu sein. Über einen Abgang Köppels wurde in der Branche immer wieder einmal spekuliert. Insgesamt verfolgt Springer ein Redaktionsmodell, das darauf hinausläuft, die Zeitungen „Welt“, „Welt am Sonntag“, „Welt kompakt“ und den Internetauftritt aus einer Hand zu gestalten. (FAZ.net, 21. Juli 2006) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Jena |
Dieser Beitrag wurde am 14.09.2006 um 21.30 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#933 Neues im Streit um die GEZ-Gebühren für Computer (vgl. hier): 12.09.2006 – Landtagsfraktionen in Schleswig-Holstein gegen GEZ-Gebühren für Computer (Meldungen bei heise online, teltarif.de) 13.09.2006 – ARD und ZDF wollen reduzierte Gebühr (Meldungen bei Spiegel online, teltarif.de) 14.09.2006 – Pressemitteilung der VRGZ zum „Sparmodell“ der Anstalten (PDF-Datei hier) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Jena |
Dieser Beitrag wurde am 22.09.2006 um 19.16 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#957 Jäger des virtuellen Schatzes Die Deutsche Nationalbibliothek soll alle deutschsprachigen Internetseiten archivieren – ein ehrgeiziges Projekt mit enormen Problemen. (Artikel in der Süddeutschen Zeitung vom 14. 9. 2006) |
| nach oben | |
|
verschoben |
Dieser Beitrag wurde am 25.09.2006 um 10.45 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#963 Schaffen Sie das? 173 Smarties innerhalb von drei Minuten mit Stäbchen essen Einen Weltrekord aufzustellen ist gar nicht so schwer / Das berühmte Guiness-Buch dazu kommt künftig vom Mannheimer Bifab Von unserem Redaktionsmitglied Matthias Kros Einen Weltrekord aufzustellen ist eigentlich gar nicht so schwer. Sagt jedenfalls Olaf Kuchenbecker, Produkt-Manager und Redakteur des berühmten "Guiness Buch der Rekorde". "Essen Sie beispielsweise 173 Smarties innerhalb von drei Minuten mit Stäbchen", fällt ihm als erste Möglichkeit ein, um in dem nach eigenen Angaben meistverkauften urheberrechtlich geschützten Buch der Welt aufgenommen zu werden. Die neueste, deutschsprachige Ausgabe des Guiness-Klassikers erstellt Kuchenbecker übrigens erstmals im Auftrag der Bibliographisches Institut & FA Brockhaus AG (Bifab). Der Mannheimer Verlag ergänzt mit dem Rekorde-Buch seine bisherige Marken-Bibliothek mit so klangvollen Namen wie Brockhaus, Duden, Harenberg und Weingarten (...) (Link) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Jena |
Dieser Beitrag wurde am 28.09.2006 um 21.49 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#975 Was US-Schüler nicht lesen sollen "Harry Potter" ist böse, J.D. Salinger verdirbt unschuldige Kinderseelen - da sind sich hysterische Moralwächter in den USA ganz sicher und nehmen reihenweise Literatur-Klassiker unter Beschuss. Autoren und Bibliotheken kontern mit einer "Woche der verbannten Bücher". (Artikel bei Spiegel online) Besonders hervorhebenswert ist der letzte Absatz: »Aus einem einzigen Verlag - Radcliffe Publishing - sind nach ALA-Angaben schon 42 der 100 wichtigsten Romane des letzten Jahrhunderts in Frage gestellt worden. Aus einem anderen Verlag gesellt sich "Fahrenheit 451" hinzu, das seit seinem Erscheinen 1953 mehrfach zensiert wurde. Autor Ray Bradbury schildert darin - unter dem Eindruck der McCarthy-Ära - eine Gesellschaft, die Bücher nicht liest, sondern verbrennt. Alles fing damit an, dass verschiedene Interessengruppen einzelne Bücher beanstandet haben ...« |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Jena |
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2006 um 22.19 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#1113 Die Stunde der unbequemen Wahrheiten Einen Referenten der Spitzenklasse erlebten die Studenten des Instituts für Industriebetriebslehre gestern an der Uni Hamburg. Auf Einladung von Professor Karl-Werner Hansmann sprach der Aufsichtsratsvorsitzende der Siemens AG, Heinrich von Pierer (65), im völlig überfüllten Hörsaal A des "WiWi-Bunkers". Mit freundlicher Lässigkeit referierte Pierer, der lange auch Siemens-Vorstandschef war, mehr als eine Stunde lang über die Herausforderungen der Globalisierung. Dabei präsentierte er den Zuhörern eine Stunde lang auch unbequeme Wahrheiten, die in der Universität noch vor wenigen Jahren für Tumulte gesorgt hätten. "Aus dem Wind, der der internationale Wettbewerb einmal war, ist längst ein Sturm geworden", so von Pierer, "und der Orkan steht uns noch bevor." Was Deutschland leisten müsse, sei "Speed und noch einmal Speed", sagte der Redner, "da draußen wartet keiner auf uns, da draußen interessiert sich keiner für unsere Befindlichkeiten." […] Qualitätsprobleme sieht von Pierer in Deutschland immer noch bei den Kindertagesstätten und Schulen. "Das sind Themen, über die eine Kultusministerkonferenz nächtelang diskutieren müsste", so von Pierer, "nicht über eine völlig überflüssige Rechtschreibreform." Auch mehr Wettbewerb zwischen den Universitäten müsse möglich sein, aber dann müsse man diesen auch mehr Autonomie geben. […] schmoo (Hamburger Abendblatt, 15. November 2006) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Jena |
Dieser Beitrag wurde am 18.12.2006 um 17.24 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#1207 „Wien sieht’s anders“ Ich kann kaum glauben, daß folgendes wirklich echt ist (Meldungen vom 14.12.2006): http://derstandard.at/?url=/?id=2695478 http://wien.orf.at/stories/157727/ http://www.wien.gv.at/nachrichten/gm.html Hat das irgend jemand schon mal auf der Straße gesehen? |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Jena |
Dieser Beitrag wurde am 31.12.2006 um 14.34 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#1236 McDeutsch: Wie global ist deutsch? Ist aus dem vermeintlich deutschen Sprachschatz längst ein internationales Gemeingut geworden? Ein Symposium zur Globalisierung der deutschen Sprache in Berlin sucht nach Antworten. (Deutsche-Welle-Beitrag vom 11. Dezember 2006) Das von der Kulturstiftung des Bundes geförderte Projekt läuft noch bis zum 31.12.2006. Eine Auswahl der unter www.berlinergazette.de erscheinenden Online-Protokolle wird in Form einer zweisprachigen Publikation im Kulturverlag Kadmos herausgegeben werden. |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Jena |
Dieser Beitrag wurde am 02.01.2007 um 16.21 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#1251 Bund fördert mit 64 Millionen Euro Rund 64 Millionen Euro soll die geisteswissenschaftliche Forschung bis 2009 vom Bundesforschungsministerium (BMBF) erhalten. Zentraler Bestandteil des Programms ist die Initiative "Freiraum für die Geisteswissenschaften". Ziel ist, Orte für geisteswissenschaftliche Spitzenforschung zu schaffen. Zu diesem Zweck sollen in Zusammenarbeit mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) "Internationale Kollegs für geisteswissenschaftliche Forschung" aufgebaut werden, die als Knotenpunkte europäischer sowie internationaler Netzwerke fungieren. Damit greift das BMBF die Empfehlungen des Wissenschaftsrates von 2006 auf. Zudem will das BMBF mit der Europäischen Union Nachwuchswissenschaftler ermutigen, international mehr zu kooperieren. Die Zusammenarbeit zwischen Naturwissenschaftlern und Geisteswissenschaftlern soll in Forschungsverbünden verbessert werden. Das Programm soll am 25. Januar starten, an dem das Jahr der Geisteswissenschaften offiziell beginnt. (Hamburger Abendblatt, 2. Januar 2007) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Jena |
Dieser Beitrag wurde am 02.01.2007 um 18.34 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#1253 KMK-Pressemitteilung Bonn, 08.12.2006 Ergebnisse der 316. Plenarsitzung der Kultusministerkonferenz in Brüssel [...] 5. Wahl des Präsidenten und des Präsidiums für das Jahr 2007 Mit Beginn des Jahres 2007 übernimmt der Berliner Senator für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner, die Präsidentschaft der Kultusministerkonferenz. Die Präsidentschaftsübergabe findet am 19. Januar 2007 in Berlin statt. Zu Vizepräsidenten der Kultusministerkonferenz für das Jahr 2007 mit Sprecherfunktionen wurden gewählt: 1. Vizepräsident Minister Jürgen Schreier, Saarland, Sprecher für Hochschule; 2. Vizepräsident Minister Henry Tesch, Mecklenburg-Vorpommern, Sprecher für Kultur; 3. Vizepräsidentin Ministerin Ute Erdsiek-Rave, Schleswig-Holstein, Sprecherin für Schule. Staatsministerin Doris Ahnen (Rheinland-Pfalz) und Staatsministerin Karin Wolff (Hessen) gehören dem Präsidium der Kultusministerkonferenz als kooptierte Mitglieder an. |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Jena |
Dieser Beitrag wurde am 10.01.2007 um 00.56 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#1308 Totgesagte leben länger Kritiker halten die Juniorprofessur als Alternative zur Habilitation für gescheitert. Die 13 Juniorprofessoren der Konstanzer Universität verteidigen in einem Essay das Modell: Die Nachwuchsforscher sind zufrieden - und rechnen sich gute Karriereschancen aus. (Artikel in UniSPIEGEL online, 12. Oktober 2006) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Jena |
Dieser Beitrag wurde am 10.01.2007 um 00.57 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#1309 Die Billigheimer der Wissenschaft Allein Berlins Hochschulen beschäftigen 4000 Lehrbeauftragte - bienenfleißige Wanderarbeiter, die das Seminarangebot sichern. Was sich kaum einer ihrer Studenten vorstellen kann: Die meisten leben auf Hartz-IV-Niveau. Und Privatdozenten lehren oft sogar für lau. 153 Euro - so viel erhielt Elisabeth Meyer-Renschhausen für ihr letztes Soziologie-Seminar an der Freien Universität Berlin. Wohlgemerkt nicht pro Monat, sondern im ganzen Semester. Darin waren enthalten: Vor- und Nachbereitung, die Seminarstunden selbst, Prüfungen, die Kontrolle von Seminararbeiten und Klausuren, natürlich auch die Betreuung der Studierenden. Man mag sich den Stundenlohn gar nicht ausrechnen. Meyer-Renschhausen ist Privatdozentin und damit verpflichtet, solche unbesoldeten Lehrveranstaltungen zu halten. Sonst würde sie ihre Lehrberechtigung verlieren - und damit die Möglichkeit auf eine Festanstellung oder die befristete Vertretung einer Professur. "Man interessiert sich natürlich für die Inhalte. Dann bereitet man sich entsprechend vor und versucht im besten Fall eine Doppelverwertung durch Zeitungsartikel", sagt die Dozentin. "Wenn ich jetzt Seminare über Hartz IV abhalte, versuche ich dann auch entsprechend Artikel zu schreiben, weil ich es für sinnvoll halte. In diesem Fall ist es mir zum Beispiel noch nicht gelungen." Neben den unbesoldeten gibt es an Universitäten auch besoldete Lehraufträge, für die ein Dozent etwa 900 Euro pro Semester erhält. Auch davon lässt sich der Lebensunterhalt nicht bestreiten. Und so überrascht das Ergebnis einer Umfrage der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) unter Berliner Lehrbeauftragten nicht: Knapp zwei Drittel von ihnen haben ein monatliches Einkommen von weniger als 1000 Euro. Dabei sind sie für die Hochschulen unverzichtbar. Sie übernehmen an den Berliner Universitäten und Fachhochschulen zwischen zehn und fünfzig Prozent der Lehre. Sabine von Oppeln, Studiendekanin an der FU Berlin, betont: "Jede Universität, die ein breites Fächerspektrum hat und auch den Anspruch, im Rahmen dieses Fächerspektrums eine breite Palette abzudecken, ist auf die Lehraufträge angewiesen. Nicht nur, um kapazitäre Löcher zu stopfen, sondern vor allen Dingen auch, um eine gewisse Vielfalt abzudecken", sagt sie. "Eine Universität ist auch ein Ort der Kommunikation zwischen Universität und Gesellschaft, dafür brauchen wir natürlich auch Lehrbeauftragte." Praxiserfahrung vom Privatdozenten Die Gruppe der Lehrbeauftragten ist sehr heterogen: Zu ihnen gehören die bereits habilitierten Privatdozenten genauso wie junge Nachwuchswissenschaftler, die gerade promovieren und Lehrerfahrung sammeln wollen. Es sind Dozenten aus dem Ausland oder Leute, die in Unternehmen fest angestellt sind und ihre Praxiserfahrungen an der Uni weitergeben. Diese Vielfalt schätzen auch die Studenten. Miriam Oesterreich zum Beispiel, die Kunstgeschichte und Spanisch studiert: "Ich glaube, dass Privatdozenten dadurch, dass sie aus einem Berufsumfeld kommen, viel weniger an die Hochschulkanon gebunden sind und deshalb auch die spektakuläreren Seminare anbieten", erklärt die Studentin. "Ich habe selbst mal ein Seminar über die Rolle des Todes in der Mexikanischen Kunst gemacht. Es ist schon cool, dass so etwas auch mal angeboten wird und nicht immer nur die gängigen Sachen aus der Kunstgeschichte, die - vom Mittelalter bis zur Neuzeit - sowieso immer angeboten werden." Obwohl der Lehrbetrieb ohne Lehraufträge deutlich an Qualität verlieren würde - für höhere Honorare fehlt den Universitäten das Geld, sagt Studiendekanin Sabine von Oppeln. Stattdessen schlägt sie vor, den Lehrbeauftragten zumindest Büroplätze oder Kopiermöglichkeiten zu bieten und ihre Situation damit zu verbessern. Elisabeth Meyer-Renschhausen hat da viel weitergehende Forderungen: "Dass man eine Umverteilung der bezahlten Arbeit macht, die Hochschullehrer selber aktiv werden und notfalls auch von ihrem eigenen Gehalt wieder etwas in Kassen geben", sagt die Privatdozentin. "Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist so entstanden, dass in der Weimarer Zeit die Hochschullehrer, die Geld verdienten, drei Prozent abgegeben haben, um damit nicht bestallte Privatdozenten zu finanzieren, um denen Forschungsmöglichkeiten zu ermöglichen." Irgendetwas müsse sich ändern, sagt Meyer-Renschhausen, aber glaubt selbst nicht recht daran. Der Umgang mit den Lehrbeauftragten macht eines deutlich: die Kluft zwischen dem allseits großen Gerede um die Bedeutung der Bildung und der Wirklichkeit an den Universitäten. (UniSPIEGEL online, 8. Januar 2007) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Jena |
Dieser Beitrag wurde am 07.02.2007 um 17.40 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#1421 Studie Hälfte der Online-Redaktionen ohne Qualitätsrichtlinien Textqualität mit grosser Bedeutung für Akzeptanz. Die Bedeutung der Textqualität für die Akzeptanz einer Website bei den Usern wurde zwar inzwischen erkannt -- dennoch besteht Nachholbedarf hinsichtlich der Qualitätssicherungsprozesse innerhalb einer Online-Redaktion. Das Qualitätsmanagement wird in vielen Online-Redaktionen vernachlässigt. Das ist eines der Ergebnisse der Content Studie 2006/2 von aexea Integrierte Kommunikation und Contentmanager.de, die nun als Studienbericht vorliegen. Über die Hälfte (52,2 Prozent) der Online-Redaktionen arbeiten ohne schriftlich fixierte Qualitätsrichtlinien. Damit wird auf ein wichtiges Instrument verzichtet, das eine gleichbleibend hohe Textqualität garantiert. Auch bei den Freigabeprozessen innerhalb der Online-Redaktionen besteht noch viel Raum zur Optimierung: 25,6 Prozent der Online-Redakteure geben ihren Artikel selbständig frei, ohne einen weiteren Kollegen oder den Chefredakteur zu Rate zu ziehen. Überraschend ist das Ergebnis, wonach nur in 42,5 Prozent der Unternehmen bzw. Online-Redaktionen die Verwendung von alter und neuer Rechtschreibung verbindlich geregelt ist. Noch erstaunlicher, dass 57,9 Prozent der Befragten kein Hilfsmittel zur Umsetzung der neuen Rechtschreibung zur Verfügung steht. 285 Web-Verantwortliche bezogen im Rahmen der Studie Stellung. Startschuss zur Content Studie 2007/1 ist gefallen. Die Befragung für die Content Studie 2007/1 hat bereits begonnen. Neben allgemeinen Fragen zur redaktionellen Arbeit widmet sich die aktuelle Content Studie dem Sonderthema Webstatistik. Ausserdem wird dem Berufsbild "Online-Redaktor" auf den Zahn gefühlt. Die Auswertung soll das "verborgene" Arbeiten von Online-Redaktionen ans Tageslicht bringen, so dass ein Benchmarking der eigenen Redaktion möglich wird. Alle Internet- und Intranet-Verantwortlichen und Online-Redakteure können die Fragen auf http://www.contentmanager.de/contentstudie beantworten. Jeder Teilnehmer erhält den Studienbericht mit allen Ergebnissen kostenlos. (persoenlich.com [„Das Online-Portal der Schweizer Kommunikationswirtschaft“], 17. Januar 2007) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Jena |
Dieser Beitrag wurde am 20.03.2007 um 14.27 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#1670 Orthografie-Nachhilfe für Manager Immer mehr Franzosen, auch solche in leitenden Positionen, stehen mit der Rechtschreibung auf Kriegsfuß. Einige Groß-Unternehmen bieten ihren Beschäftigten Kurse gegen die Verwilderung der Schriftsprache an Paris. Mit nur drei Fehlern hatte Natalie den Diktat-Wettbewerb in ihrem Club-Dorf in den Sommerferien gewonnen. Eine gute Leistung sei das, lobte der Prüfer. Dass jemand einen fehlerfreien Text ablieferte, liegt freilich schon lange zurück. Für immer mehr Franzosen erweist sich die Orthografie ihrer Muttersprache als wahre Fallgrube. "Würden wir nur Leute einstellen, die in ihren Bewerbungen keine Fehler machen, könnten wir unseren Personalbedarf nicht decken", resigniert der Personalchef einer großen Pariser Bank. Andere hingegen wollen so schnell nicht kapitulieren. In der renommierten Pariser Ingenieurschule ECE steht ein Diktat pro Woche auf dem Stundenplan der jungen Techniker. Aufgenommen wird ohnehin nur, wer die schriftliche Aufnahmeprüfung weithin fehlerfrei besteht. Fast zehn Prozent aller Bewerber scheiterten schon an dieser Hürde, sagt der Direktor dieser Eliteschule, Pascal Brouaye. Mit dem Französischen haben die Franzosen schwer zu kämpfen. Sieben von zehn Franzosen halten ihre Muttersprache, über deren Reinheit und Regeln Dutzende von Kommissionen wachen, selbst für "schwierig". "Die französische Rechtschreibung ist eine Art Religion. Man muss sie befolgen. Sonst ist das Sünde", überspitzte der Sprachwissenschaftler Bernard Cerquiglini schon vor Jahren den Stellenwert von Grammatik und Orthografie in einem Land, das Diktate tatsächlich als nationalen Volkssport nicht nur in den Sommerferien betreibt. Dabei beklagen inzwischen längst nicht mehr nur die "grandes ecoles" und die Universitäten das sinkende Rechtschreibniveau der Studenten. Auch in den Unternehmen häufen sich die Klagen über die Orthografie-Schwächen der Angestellten. Als Schuldigen haben die Chefs großer Personalbüros in erster Linie die umstrittene Ganzheitsmethode in den Schulen ausgemacht, weisen aber auch den neuen schnellen Kommunikationsmitteln wie Mails und SMS eine gehörige Mitschuld an der Verwilderung der Schriftsprache zu. Große Unternehmen wie die Staatsbahn SNCF, der Telefonkonzern Bouygues, aber auch einige Banken bieten ihren Beschäftigten neuerdings Nachhilfekurse in der Schriftsprache an. Auch das nationale Zentrum für Fernunterricht Cned notiert seit gut einem Jahr einen kräftigen Anstieg bei den Orthografiekursen. Andere Unternehmen wiederum geben sich längst fatalistisch. "Rechtschreibfehler sind heute üblich, gehören fast schon zum guten Ton", sagt der Personalchef eines großen Unternehmens. "Auch Kundenbeschwerden, die bei uns eintreffen, strotzen doch vor Fehlern." Da darf man sozusagen auf dem gleichen Niveau zurückschreiben. 16.03.2007 Von Joachim Rogge (Link) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Jena |
Dieser Beitrag wurde am 19.10.2007 um 17.49 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#2412 19. Oktober 2007, 11:43 Uhr Von Joachim Peter Interview Schavan will noch mehr Elite-Universitäten Heute werden zum zweiten Mal deutsche Elite-Universitäten gekürt. Forschungsministerin Schavan will den Wettbewerb weiter fortsetzen. Auf WELT ONLINE erklärt sie, was sie sich davon verspricht, und warum sie bald Seniorenprofessuren einrichten will. WELT ONLINE: Frau Ministerin Schavan, heute endet die zweite und letzte Runde der Exzellenzinitiative. Wie geht es mit dem Eliteuni-Wettbewerb weiter? Annette Schavan: Ich werde mich für eine Verstetigung der Exzellenzinitiative einsetzen. Spätestens im Sommer 2009 sollte es eine neue Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern geben. Zuvor werden Erfahrungen aus den ersten beiden Runden ausgewertet. Außerdem müssen wir Antworten finden auf Fragen wie etwa nach der Stärkung von Exzellenz in der Lehre oder exzellenten Zukunftskonzepten an Fachhochschulen. WELT ONLINE: Eine Bundesliga der Hochschulen, wie sie der Wissenschaftsrat ins Gespräch gebracht hat, ist demnach vom Tisch? Schavan: Nein, auch dieser Vorschlag bleibt in Spiel. WELT ONLINE: Der eben gekürte Nobelpreisträger Gerhard Ertl hat den Wettbewerb kritisiert und gefordert, die Gelder besser gleich in die Hände der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu geben. Schavan: Die Deutsche Forschungsgemeinschaft erhält bereits mehr Geld als bisher, etwa durch die Programmkostenpauschale, um die universitäre Forschung zu stärken. Die Exzellenzinitiative verfolgt jedoch noch zwei weitere Ziele: die Förderung von exzellenten Konzepten im Bereich der Graduiertenförderung und die Förderung von kompletten Zukunftskonzepten der Universitäten. Das ist ein zusätzlicher Akzent, der uns noch weiter voranbringen wird. Die internationale Wahrnehmung der Exzellenzinitiative ist übrigens immens – das bestärkt mich, diesen Weg weiterzugehen. WELT ONLINE: Der Jülicher Physiker und Nobelpreisträger Peter Grünberg erfand die Festplatte, die wir heute etwa in Mp3-Musikspielern und Computern finden. Zeigt das nicht einmal mehr, dass große Innovationen in Deutschland zu selten in Produktionsreife gelangen? Schavan: Deshalb haben wir mit der Hightech-Strategie einen neuen forschungspolitischen Ansatz, der die ganze Wertschöpfungskette in den Blick nimmt. An der Wissenschaft hapert es jedenfalls nicht. Die Wirtschaft trägt die Bringschuld. WELT ONLINE: Beide Nobelpreisträger haben inzwischen die Pensionsgrenze erreicht. Können wir es uns tatsächlich leisten, Koryphäen in den Ruhestand zu schicken? Schavan: Nein, deshalb bereiten wir die Seniorprofessur für das kommende Jahr vor. Im Dienstrecht hat das Kabinett in dieser Woche eine erste wichtige Vorraussetzung zur Flexibilisierung der Altergrenze geschaffen. WELT ONLINE: Einige Wissenschaftler, die an embryonalen Stammzellen forschen, verlangen die Abschaffung der Stichtagesregelung für den Import der Zelllinien. Verhindert die gesetzliche Regelung tatsächlich wissenschaftlichen Fortschritt? Schavan: Von Wettbewerbsnachteilen unseres Sonderweges kann überhaupt keine Rede sein. Deutschland ist in der Stammzellenforschung international hoch anerkannt. Die Konzentration der Forschungsförderung auf Alternativen war und ist richtig. Die Erfolge sind erstaunlich. Das neueste Programm betrifft Wege zur Reprogammierung adulter Stammzellen. Das hat bis vor zwei Jahren noch niemand für möglich gehalten. Wir brauchen keine Kursänderung. WELT ONLINE: Sie wollen also an der Stichtagesregelung festhalten? Schavan: Ja, allerdings gibt es ein ethisches Dilemma: Bedeutende Forscher der adulten Stammzellenforschung vertreten die Auffassung, dass man das Wissen aus der embryonalen Stammzellenforschung benötigt, um bei der eigenen Forschungsarbeit vorankommen zu können. Vor diesem Hintergrund halte ich eine Verschiebung des Stichtages, solange er in der Vergangenheit liegt und keinen Anreiz für den Verbrauch von Embryonen schafft, für richtig. Einen Wegfall der Stichtagsregelung schließe ich hingegen aus. Das würde die Substanz des Gesetzes schädigen. Der Lebensschutz muss der Forschung auch in Zukunft Grenzen setzen. Das ethische Dilemma ist nicht auflösbar. (Link) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Jena |
Dieser Beitrag wurde am 09.11.2007 um 18.35 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#2512 01.11.2007 - Medizin Mit Hörtraining gegen Legasthenie Forscher: Das Gehör zu schulen, kann bei Lese-Rechtschreib-Schwäche helfen Ein Hörtraining kann Legasthenikern beim Umgang mit Sprache helfen: Es verändert die Gehirnaktivität so, dass die Betroffenen Sprache besser verstehen können, haben amerikanische Forscher in einer Studie mit legasthenischen Kindern gezeigt. Während die Gehirne der Kinder vor dem Training auf schnelle Tonfolgen verzögert reagierten, war die Aktivierung nach dem Training vergleichbar mit der bei Kindern ohne die Lese-Rechtschreib-Schwäche. Übungen mit Tönen können also die Verdrahtungen im Gehirn verändern und dadurch die Sprachverarbeitung bei Kindern mit Legasthenie verbessern, folgern die Forscher. Die Wissenschaftler erfassten die Gehirnaktivität von neun- bis zwölfjährigen Kindern, während diese zwei verschiedene Tonfolgen hörten: eine mit langsam wechselnden und eine mit schnell wechselnden Tonhöhen. Bei den Tönen handelte es sich nicht um Sprache, aber um Tonmuster, die ähnlich auch in der gesprochenen Sprache vorkommen. Bei gesunden Kindern reagierte das Gehirn stärker auf die schnellen Tonfolgen als auf die langsamen: Hier waren insgesamt elf Gehirnregionen deutlich aktiviert. Bei Kindern mit Legasthenie war dieses Aktivierungsmuster dagegen nicht zu beobachten. Stattdessen verarbeiteten sie die schnellen Tonfolgen fast genauso wie die langsamen. "Dieses Muster ist ganz offensichtlich falsch", sagt Studienautorin Nadine Gaab von der Kinderklinik in Boston. "Aber um Sprache zu verstehen und später Buchstaben oder Silben richtig zu schreiben, müssen die Kinder schnelle Tonwechsel richtig erkennen können". Um diese Verarbeitung zu verbessern, trainierten Gaab und ihre Kollegen die legasthenischen Kinder acht Wochen täglich mit Hilfe eines Computerprogramms. Dabei hörten die Kinder zuerst langsame Tonfolgen, später wurden diese schneller und komplexer und umfassten auch Silben, Wörter und Sätze. Nach dem Training wurde die Gehirnaktivität der Kinder erneut gemessen. Tatsächlich reagierten die Gehirne der Kinder mit der Lese-Rechtschreib-Schwäche nach dem Training auf die schnellen Tonfolgen ähnlich wie die gesunder Kinder. Außerdem verbesserte sich auch die Lesefähigkeit der Kinder. Die neue Methode könnte es Forschern eines Tages erlauben, Legasthenie frühzeitig zu erkennen, meint Gaab. Mithilfe der Gehirn-Daten könnte die Schwäche schon erkannt werden, bevor die Kinder anfangen zu lesen. Ob allerdings alle Legastheniker von einem solchen Training profitieren, können die Forscher noch nicht sagen. http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/news/285015.html |
| nach oben | |
|
Karin Pfeiffer-Stolz Düren |
Dieser Beitrag wurde am 10.11.2007 um 07.36 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#2513 Der Computer wird's schon richten. Wer an dieses Märchen glaubt, sollte sich das folgende Buch beschaffen, hochinteressante Lektüre: Barry Sanders. Der Verlust der Sprachkultur. S. Fischer Verlag 1995 (antiquarisch zu haben, gute Rechtschreibung) Sprechen lernt man nur in lebendigen, in sozialen Bezügen. Also im Gespräch mit Menschen, nicht beim Herumfummeln mit dem Computer. Weshalb zum Teufel wollen Menschen ihre Kinder nicht mehr selbst unterrichten und aufziehen? Soll das jetzt auch bald maschinell vor sich gehen? |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Jena |
Dieser Beitrag wurde am 16.11.2007 um 11.17 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#2558 Leopoldina ist deutsche Akademie der Wissenschaft (halle.de/ddp) Die Leopoldina in Halle (Saale) ist die neue Deutsche Akademie der Wissenschaft. Die älteste Einrichtung ihrer Art in Europa sei prädestiniert, Deutschland im Kreis der internationalen Akademien zu vertreten, sagte Bundeswissenschaftsministerin Annette Schavan (CDU) am Freitag im Deutschlandfunk. Die Generalsekretärin der Leopoldina Professor Jutta Schnitzer-Ungefug erklärte, dass die Leopoldina mit dieser offiziellen Anerkennung damit als einzige Akademie das Recht hat, Deutschland international zu verteten. Mit Hilfe der Akademie wird laut Schavan die Zusammenarbeit von Politik und Wissenschaft, etwa im Bereich der Klimapolitik, intensiviert. Sachsen-Anhalt habe der Entscheidung zugestimmt. Schavan sprach von einem guten Zeichen für die neuen Bundesländer. Die Bundeswissenschaftsministerin begründete die Entscheidung gegen die Neugründung einer Akademie mit dem internationalen Ansehen der Leopoldina. Deren Präsident, der Virologe Volker ter Meulen, sei bereits heute der Vorsitzende der Akademiepräsidenten in Europa. Die deutsche Akademie der Wissenschaft wird Schavan zufolge je nach Lage mit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der neugegründeten Akademie für Technikwissenschaft zusammenarbeiten. Der Leopoldina gehören derzeit nach eigenen Angaben weltweit 1250 Mitglieder an. Darunter sind 33 Nobelpreisträger, etwa der diesjährige Träger des Chemie-Nobelpreises, Gerhard Ertl. 16.11.2007 http://www.halle.de/index.asp?MenuID=887&NewsID=19009 |
| nach oben | |
|
Karin Pfeiffer-Stolz Düren |
Dieser Beitrag wurde am 16.11.2007 um 15.12 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#2564 In einem heutigen Telefonat erwähnte eine Lehrerin zum Thema Schreibschrift, diese werde heute "nicht mehr verlangt"; es genüge, wenn den Schülern die Druckschrift beigebracht werde. Solche pädagogischen Umtriebe verursachen aus verschiedenen Gründen Unbehagen, die hier aber nicht Thema sein sollen. Seit dem Telefonat beschäftigt mich jedoch unter anderem die Frage, ob die Fertigkeit des Lesens nicht eng mit dem Schreibenkönnen verbunden ist. Ist vorstellbar, daß sich beim Schüler eine sehr gute Lesefertigkeit entwickelt, wenn das Schreiben nicht gleichzeitig im selben Maße gepflegt wird? Sind beide Fertigkeiten – das Lesen und das Schreiben – nicht miteinander verschränkt, also zwei verschiedene Seiten einer Medaille? Bedingen sie denn nicht einander? Falls meine Vermutung zutrifft, hätte die Herabsetzung der Anforderungen im Bereich der Handschrift auf lange Sicht fatale Folgen. Gibt es unter den Foristen jemanden, der sich mit dieser Frage bereits beschäftigt hat und mir diesbezüglich Impulse geben kann? |
| nach oben | |
|
Christoph Schatte Poznan |
Dieser Beitrag wurde am 16.11.2007 um 18.31 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#2568 Die Frage von Karin Pfeiffer-Stolz, "ob die Fertigkeit des Lesens nicht eng mit dem Schreibenkönnen verbunden ist", kann etwas erhellt werden, wenn man die Schreibleistungen von deutschen Germanistikstudenten wie auch von Deutsch als Fremdsprache Studierenden über die letzten vier Jahrzehnte verfolgt. Als es noch keine Kopiergeräte gab, mußte i.d.R. alles exzerpiert, abgeschreiben, umgeschrieben usw. werden. Nach der anfänglichen Verbreitung von Kopierern hieß es dann schon etwas orakelnd "Kopieren ist leichter als kapieren". Die Schreibsicherheit der damals notgedrungen viel Schreibenden war evident besser als die der heute (wenig) Schreibenden. Außerdem war die Sicherheit im Vorlesen deutlich höher als heute. Auslandsgermanisten sind schreibsicherer als deutsche Germanisten, weil sie sich die Graphie grammatisch und etymologisch bewußter einprägen müssen als deutsche Muttersprachler. Schreiben ist zudem ein teilkörperlicher Nachvollzug von Laut- und Schriftbildern und damit entschieden intensiver als Lesen oder Hören allein (ähnlich wie im Artikulatorischen Vorlesen nach dem Lesen). Die oben dargestellte Lage ändert sich seit der Deformation der deutschen Graphie allerdings schnell und gravierend. Die ausgeheckten Regeln liegen außerhalb wie auch immer gearteter Motivation, sind also entschieden arbiträrer als die der klassischen Schreibung. Die unsilbische Heysesche s-Schreibung hat keine Vorteile in der Lesesicherheit gezeitigt, dagegen evidente Nachteile in der Schreibsicherheit. Lese- und Schreibfertgkeiten werden weitgehend komplementär erworben, mit der Einschränkung, daß man beim Schreiben von nur Gehörtem, aber nie Gelesenem im Falle fehlender graphemischer Motiviertheit unsicher sein kann. Die zunehmend beliebten (und Eltern wie Großeltern kleiner Kinder stimmlich entlastenden) Hörbücher vermitteln schriftsprachlichen Wortschatz ohne Schriftbilder. Die Technik macht´s möglich. Falls Pädagogen nach der Genese der größer werdenden Schar von "Schriftfernen" in (Hör)bibliotheksnähe suchen sollten, können sie diesen Umstand in( ihr erzieherische)s Auge fassen. |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Jena |
Dieser Beitrag wurde am 03.12.2007 um 19.53 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#2632 Macht der Masse Immer mehr Firmen setzen auf »Crowdsourcing« und machen Internetnutzer zu Tagelöhnern Von Matthias Becker »Ich versteh’ das nicht!« Einigermaßen verzweifelt sucht die junge Italienerin Isadora in einem Internetforum Rat: »Ich habe gestern ein paar Aufgaben für ungefähr 30 Dollar gemacht. Sie sind auch sofort akzeptiert worden, aber jetzt erscheint das Geld einfach nicht auf meinem Konto! Was soll ich tun?« Ein anderer Forumsteilnehmer antwortet sofort: »Ich habe dasselbe Problem. Der Kontaktschalter auf der Seite funktioniert nicht; ich weiß nicht, wie ich die richtigen Leute erreichen soll.« Und ein dritter ergänzt: »Genau! Da kommt immer nur die Meldung: ›Bitte versuchen Sie es später noch einmal!‹« Isadora sitzt in Italien vor ihrem Rechner, die anderen beiden in den USA. Ihr gemeinsames Problem: Sie haben sogenannte »Human Intelligence Tasks« (HIT) am Computerbildschirm erfüllt, Aufgaben, die »für Computer außerordentlich schwierig, für Menschen dagegen einfach sind«, wie die Online-Agentur Mechanical Turk definiert. Isadora und die anderen verbessern die Rechtschreibung in computergenerierten Texten, finden passende Schlagworte für Bilder oder verschriftlichen Tonaufnahmen. Dafür erhalten sie eine Art digitalen Stücklohn. Für das Übertragen einer Minute gesprochener Sprache sind 19 US-Cent zu haben, für das Beantworten einer Frage bei einer Marktforschungsstudie 1 Cent. Mechanical Turk ist Teil von Amazon, ein sogenannter »Matchmaker«: Unternehmen finden hier Mitarbeiter zu konkurrenzlos günstigen Preisen, Internetnutzer einen Zeitvertreib, bei dem sich zusätzlich etwas verdienen läßt. Nun aber hat eine Firma nicht rechtzeitig überwiesen. Innerhalb von Minuten macht die Nachricht in dem Forum namens »Turker Nation« die Runde. Hier tauschen die Online-Tagelöhner Ratschläge aus oder warnen sich vor Unternehmen mit schlechter Zahlungsmoral. Das Online-Kaufhaus Amazon begann vor drei Jahren, menschliche Interpretationsleistung in sein Angebot einzubinden. Es hatte sich herausgestellt, daß Computerprogramme nicht entscheiden konnten, welche Internetseiten das gleiche Produkt anboten. Deshalb begann die Firma, den Besuchern einige Cent für jede korrekt identifizierte Doppelung zu zahlen. Heute bearbeiten mehr als 100000 Menschen aus über 100 Ländern Aufträge, die sie auf der Internetseite gefunden haben. (Wie viele es genau sind, behält Amazon allerdings lieber für sich.) Den Namen erfand Vorstandsvorsitzender Jeff Bezos, in Anlehnung an den vermeintlichen Schachautomaten »Der Türke«, der im späten 18. Jahrhundert verblüffte. Scheinbar konnte die Maschine Schach spielen, in Wirklichkeit verbarg sich im Gehäuse ein kleinwüchsiger Schachmeister. Bezogen auf den »mechanischen Türken« von heute ein hintersinniges Bild: die »künstliche künstliche Intelligenz« – so der Ausdruck Amazons für die menschliche Verstehensleistung – ermöglicht der digitalen Technologie erst zu funktionieren. Aber wie zuverlässig sind Transkripte, die auch bei äußerster Arbeitsgeschwindigkeit kaum drei Euro Stundenlohn einbringen? Weil die Qualitätskontrolle durch qualifizierte Kräfte die Kosten wieder anheben würde, nutzen Unternehmen wie CastingWords auch dafür die Arbeitskraft im Netz: Sie bezahlen andere Internetnutzer für die Beurteilung, ob die schriftliche Version der Sprachaufnahme korrekt ist. Die Masse arbeitet nicht nur selbständig, sie kontrolliert sich dabei auch selbst. Rob aus den Niederlanden ist seit anderthalb Jahren dabei und verbringt etwa »ein bis drei Stunden am Tag« mit den HIT, »aber das ist keine kontinuierliche Arbeit, das mache ich so nebenbei«. Dafür bekommt er ungefähr 90 Dollar (62 Euro), für die er sich dann Bücher und Comics bei Amazon bestellt. So machen es die meisten; ihren Verdienst lassen sie sich in Sachwerten auszahlen. Das Unternehmen profitiert so gleich zweifach: Die »Anfrager« genannten Arbeitgeber bezahlen mindestens zehn Prozent der ausgeschriebenen »Belohnungen« an Amazon, und die »Löhne« der Turker steigern den Umsatz. Im Sommer 2006 fand Jeff Howe, Redakteur des Magazins Wired, den Begriff für solche Strategien: »Crowdsourcing«, zusammengesetzt aus den Wörtern Outsourcing und Crowd, englisch für Masse. Warum für Leistungen bezahlen, wenn sie im Internet scheinbar kostenlos zur Verfügung stehen? Schon lange senken Unternehmen durch Selbstbedienung Preise und verschaffen sich so einen Konkurrenzvorteil. Durch das Internet haben sich die Möglichkeiten dazu gewaltig vermehrt (Online-Banking, Online-Shopping etc.). Heute ist solche »Konsumentenarbeit« eher die Regel als die Ausnahme. Aber Crowdsourcing geht darüber hinaus: Nun wird die Arbeit der Massen nicht nur am Ende der Kette in die Produktion eingebunden. Sie wird zum Bestandteil der Produktentwicklung, -gestaltung und, soweit es sich um digitalisierte Inhalte handelt, sogar der Herstellung. Wirtschaftswissenschaftler sprechen von »interaktiver Wertschöpfung« oder »Peer Production«. Der Antrieb der Zuarbeiter ist weniger Gelderwerb als der Wunsch nach Anerkennung, Spaß an Herausforderungen und Stolz auf die eigene Leistung. Nicht zufällig werden viele Crowdsourcing-Aufgaben als Wettbewerbe gestaltet. Oft arbeiten Internetnutzer, ohne es zu merken: Sie versehen nebenbei Bilder mit Schlagworten, diskutieren miteinander, bewerten Textbeiträge und schaffen so profitable Datensammlungen. Während immer mehr Unternehmensberater Crowdsourcing propagieren, immer mehr Firmen es zur Rationalisierung einsetzen, stellte ein US-amerikanischer Blogger kürzlich die Frage: »Wenn wir Lesezeichen setzen oder etwas von unserem Wissen teilen und dadurch Del.icio.us oder Technorati oder Yahoo helfen, erfolgreichere Unternehmen zu werden, machen wir dann nicht unser kostbarstes Gut – die Zeit – zur billigen Massenware?« (Junge Welt, 27. 11. 2007) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Jena |
Dieser Beitrag wurde am 14.02.2008 um 18.09 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#2964 Schilda in Stockelsdorf: Der Bindestrich-Disput Stockelsdorf - Okonek-Straße oder Okonekstraße? Muss das Straßenschild im Neubaugebiet an der Stockelsdorfer Schulstraße womöglich weichen, weil dessen Schreibweise nicht korrekt ist? Wie man sich bei solch einer Frage im Gestrüpp der neuen deutschen Rechtschreibung verheddern kann, dafür lieferte die Sitzung der Gemeindevertretung einen anschaulichen Beleg. Ein Hauch von Schilda wehte Montag Abend durch die Sitzung im Herrenhaus. Es ging dabei um die Widmung von Straßen. Eigentlich ein schlichter, rein formeller Verwaltungsakt, bei dem einer Straße die Eigenschaft einer öffentlichen Straße zuerkannt und sie damit zu einer für den öffentlichen Verkehr bestimmten öffentlichen Sache gemacht wird. Doch die Widmung zweier nach den Partnergemeinden benannten neuen Wohnstraßen nahm der CDU-Gemeindevertreter Dr. Kevin Dierck zum Anlass für eine Klarstellung. "Le-Portel-Ring", befand Dierck, das gehe in Ordnung. Aber "Okonek-Straße" entspreche nun ganz und gar nicht der geltenden deutschen Rechtschreibung. Der Bindestrich solle weg - diese Änderung müsse im Sinne einer korrekten Schreibweise schon sein, meinte der Gemeindevertreter, und er nahm dabei die Gemeindeverwaltung in den gestrengen Blick. Denn was in einer Klassenarbeit als Fehler rot angestrichen würde, klare Sache für ihn, das dürfe so nicht auf offiziellen Schildern prangen. Diercks Parteifreund Hartmut Hamerich plädierte ebenfalls dafür, dem Duden gerecht zu werden, während SPD-Fraktionschef Otfried Krämer fix darauf verwies, es sei doch wohl sein CDU-Kollege Andreas Gurth gewesen, der sich für diese Schreibweise stark gemacht habe. Woran sich dieser nicht mehr so genau erinnern mochte. Helmut Neu (UWG) schließlich steuerte bei, dass sich die Gemeindevertreter bei so einer Entscheidung "auf die intellektuellen Fähigkeiten der Verwaltung verlassen können müssen". Können sie auch, trumpfte Bürgermeisterin Brigitte Rahlf-Behrmann später auf. Denn ein Protokoll des Ausschusses für Umwelt, Planung und öffentliche Ordnung belege: "Es ist Bauamtsleiter Dieter Rodewald gewesen, der bei der Namensgebung ausdrücklich darauf verwiesen hat, dass es nicht der deutschen Rechtschreibung genügt, wenn wir ,Okonek-Straße' schreiben", betonte sie. Gleichwohl: Der Ausschuss wollte den Bindestrich. Und wie geht's nun weiter? Bleibt der Bindestrich oder muss er weichen? Im Sinne des Dudens liegt Dierck völlig richtig, wie ihm auch Pädagogen bescheinigen. Doch ob es zu der Anregung, der deutschen Sprache nun unbedingt genüge zu tun und die Schreibweise entsprechend zu ändern, wirklich kommt: Daran sind Zweifel angebracht. Gewichtige Argumente gegen die Auswechslung des inkriminierten Straßenschildes führt die Verwaltungschefin ins Feld. Brigitte Rahlf-Behrmann weist, aller Achtung vor korrektem Deutsch zum Trotz, auf eines hin: "Wir müssen auch an die Anwohner der Straße denken. In ihren Ausweispapieren findet sich bereits als Adresse ,Okonek-Straße'", gibt sie zu bedenken. Sogar in sämtlichen notariellen Verträgen finde sich diese Schreibweise. Und dass die betroffenen Anwohner schon ihre Briefköpfe und Visitenkarten mit dem unkorrekt geschriebenen Namenszug versehen haben: "Sollen die sich etwa alles neu drucken lassen?", so Rahlf-Behrmanns eher rhetorische Frage. Bleibt also abzuwarten, ob und wie sich der Fachausschuss erneut mit diesem Bindestrich-Problem auseinandersetzt. Angesichts des eher humorvollen Geplänkels im Herrenhaus über Sinn oder Unsinn eines kurzen schwarzen Strichs wies Bürgervorsteher Harald Werner am Ende auf etwas ihm viel Wesentlicheres, etwas viel Bedenklicheres hin: Dieser Disput sei ihm allemal lieber gewesen, bekannte Werner, als völlig unangemessene Reaktionen aus der Bevölkerung darüber, "dass wir eine Straße nach einer polnischen Stadt benannt haben". Den Bürgervorsteher empören "diese Ewiggestrigen", die den Straßennamen ganz gestrichen sehen wollen - egal, ob mit oder ohne Bindestrich. Von Lothar Braun, LN (Lübecker Nachrichten, 13. Februar 2008) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Jena |
Dieser Beitrag wurde am 14.02.2008 um 18.17 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#2965 Akustik-Training hilft Legasthenikern Sprachverarbeitung kann durch Übungen verbessert werden Von Roswitha Wurm Wien. Von einer Legasthenie (spezielle Lese-Rechtschreib-Schwäche) spricht man, wenn sich bei Kindern mit normalem bis überdurchschnittlichem Intelligenzquotienten beim Schriftspracherwerb (beim Lernen des Lesens und Schreibens) Probleme ergeben, welche durch differenzierte Sinneswahrnehmungen hervorgerufen werden. Dies führt zu Wahrnehmungsfehlern beim Lesen und Schreiben. Die spezielle Lese-Rechtschreib-Schwäche ist anlagebedingt. Neueren Forschungen haben biogenetische Ursachen für Legasthenie bisher in sechs Chromosomenregionen (1, 2, 3, 6, 15 und 18) identifiziert. Das bedeutet, dass man Legasthenie nicht verhindern, sehr wohl aber schulische Probleme durch frühkindliche Förderung kleiner halten kann. Die Erfahrung in der Praxis zeigt, dass ein überdurchschnittlich großer Prozentsatz legasthener Kinder Defizite im akustischen Bereich aufweist. Buchstaben, Laute und Wörter, die nicht richtig vom Gehirn aufgenommen werden, können bei betroffenen Schülern nicht in angemessener Weise mündlich oder schriftlich wiedergegeben werden. Eine aktuelle Studie der Kinderklinik Boston unter der Leitung von Professor Nadine Gaab erbrachte diesbezüglich interessante Ergebnisse: Wissenschafter erfassten die Gehirnaktivität von neun- bis zwölfjährigen Kindern, während diese zwei unterschiedlich rasch wechselnde Tonfolgen hörten. Es handelte sich um Tonmuster, die in ähnlicher Weise auch in gesprochener Sprache enthalten sind. Bei nicht legasthenen Kindern reagierte das Gehirn in elf Regionen deutlich auf schnelle Tonfolgen. Dieses Aktivierungsmuster war hingegen bei legasthenen Versuchskindern nicht zu beobachten. "Um Sprache zu verstehen und später Buchstaben oder Silben richtig zu schreiben, müssen Kinder schnelle Tonwechsel richtig erkennen können", meint Gaab. Zur Verbesserung dieser Fertigkeiten trainierten die Wissenschafter in der Kinderklinik Boston legasthene Kinder acht Wochen lang täglich mit Hilfe eines Computerprogramms. Dabei hörten sie zunächst langsame, später schnellere und komplexere Tonfolgen, die auch Silben, Wörter und Sätze umfassten. Nach dem Training wurde die Gehirnaktivität der Kinder erneut gemessen. Tatsächlich reagierten die Gehirne der Kinder mit Legasthenie nach dem Training auf die schnellen Tonfolgen ähnlich wie die nicht legasthener Kinder. Zudem verbesserte sich die Lesefähigkeit. Diese Erkenntnis könnte es in naher Zukunft ermöglichen, Legasthenie bereits im Vorschulalter zu diagnostizieren. Frühzeitige Förderung Betroffener mit akustischen Übungen würden die Vernetzungen im Gehirn verändern und dadurch die Sprachverarbeitung bei Kindern mit Legasthenie verbessern. Dies wäre ein Meilenstein in der Entwicklung pädagogischer Förderungsprogramme für Legastheniker. (Wiener Zeitung, 7. Februar 2008) |
| nach oben | |
|
David Konietzko Bad Homburg vor der Höhe |
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2008 um 18.12 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#2976 Zu #2964: Die Schreibung Okonek-Straße entspricht den amtlichen Regeln. »Man kann einen Bindestrich in Zusammensetzungen setzen, die als ersten Bestandteil einen Eigennamen haben, der besonders hervorgehoben werden soll, oder wenn der zweite Bestandteil bereits eine Zusammensetzung ist« (§ 51). |
| nach oben | |
|
Wolfram Metz Den Haag, Niederlande |
Dieser Beitrag wurde am 19.02.2008 um 00.15 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#2977 Der Blick ins Regelwerk lehrt vor allem eins: Die »amtliche Schreibung« von Eigennamen entspricht nicht immer den Vorgaben der Regler und ist dennoch gültig, siehe z. B. die Vorbemerkungen zu Teil A (Laut-Buchstaben-Zuordnungen): »Für Eigennamen [...] gelten im Allgemeinen amtliche Schreibungen. Diese entsprechen nicht immer den folgenden Regeln.« oder eben auch zu Teil C (Schreibung mit Bindestrich): »Die Schreibung mit Bindestrich bei Eigennamen entspricht nicht immer den folgenden Regeln, so dass nur allgemeine Hinweise gegeben werden können. Zusammensetzungen aus Eigennamen und Substantiv zur Benennung von Schulen, Universitäten, Betrieben, Firmen und ähnlichen Institutionen werden so geschrieben, wie sie amtlich festgelegt sind.« Speziell zu Straßennamen findet sich in § 37, der die Zusammenschreibung von Zusammensetzungen aus Substantiven regelt, unter E2 der Hinweis: »Das betrifft auch Eigennamen mit dieser Struktur – es handelt sich besonders um Straßennamen (Bahnhofstraße, Schopenhauerstraße [...]).« Ratzebuhr hin oder her, der Bindestrich in Okonek-Straße ist so überflüssig wie ein Kropf, aber wenn er die Beteiligten glücklich macht … Möglicherweise handelt es sich um genau jenes Hyphen, das der Hannover Messe (der alljährlich in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannov stattfindenden größten Industriemesse der Welt) so schmerzlich abgeht. |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Jena |
Dieser Beitrag wurde am 27.03.2008 um 16.32 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#3082 Jutta Limbach geht in Rente Mit 74 Jahren «etwas mehr Freiheit» - Erste Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts und des Goethe-Instituts Von Roland Losch München (AP) Wer das Büro von Jutta Limbach betritt, muss über Bücherberge und aussortierte Papierstapel steigen. Mit 74 Jahren ist die Präsidentin des Goethe-Instituts auf dem Sprung in den Ruhestand. «Ich war gerne hier. Aber ich freue mich auf das, was kommt», sagt sie und lacht: «Ich bin froh, dass ich etwas mehr Freiheit bekomme. In dem Ehrenamt arbeitete sie mitunter noch mehr als zuvor als Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts. «Manchmal hatte ich den Eindruck. Und mein Mann auch», sagt sie. In knapp sechs Jahren besuchte sie weltweit 51 Goethe-Institute, immer mit ein, zwei Vorträgen im Gepäck. Nach langer Talfahrt durch ständige Kürzungen der Bundeszuschüsse ist das Haus jetzt wieder im Aufwind. Am 31. März übergibt Limbach das Amt in einem Festakt mit Außenminister Frank-Walter Steinmeier an ihren Nachfolger Klaus-Dieter Lehmann. Just an diesem Tag feiern Limbach und ihr Mann auch ihren 44. Hochzeitstag. «Für uns ein Anlass, mehr gemeinsam zu tun», sagt sie. «Wir haben ja eine ambulante Ehe geführt. Künftig will das Paar, das drei erwachsene Kinder hat, in Berlin wohnen. Dort wurde Jutta Ryneck am 27. März 1934 geboren. Ihre Großmutter war Mitglied der Weimarer Nationalversammlung und des Reichstags, ihr Vater nach 1945 Bürgermeister des Berliner Stadtteils Pankow. Auch sie selbst trat der SPD bei. Berufsziel Journalistin Jura studierte sie eigentlich nur, weil sie Journalistin werden wollte. Stattdessen machte Jutta Limbach Karriere als Professorin, bis sie 1989 Justizsenatorin ihrer Heimatstadt wurde. Sie legte RAF-Häftlinge zusammen, löste die Politische Abteilung der Berliner Staatsanwaltschaft auf, ließ nach der Wiedervereinigung DDR-Richter überprüfen, kritisierte die Freilassung von Erich Honecker 1993 und drang vergeblich auf eine neue gesamtdeutsche Verfassung. Ein Jahr später erfüllte sich ein Traum für sie: Limbach wurde Richterin am Bundesverfassungsgericht und rückte, nach der Wahl Roman Herzogs zum Bundespräsidenten, als erste Frau an die Spitze des höchsten deutschen Gerichts. In ihre Amtszeit fielen heiß diskutierte Entscheidungen wie das Kruzifix-Urteil, zum Asylrecht oder zur Rechtschreibreform. Als Präsidentin berief sie Frauen zur Pressesprecherin und Direktorin und sorgte mit Halbtagsstellen dafür, dass mehr wissenschaftliche Assistentinnen am höchsten Gericht eine Karriere starten konnten. "Das schönste Ehrenamt, das die Republik zu vergeben hat" Als Limbach mit Erreichen der Altersgrenze aus dem Richteramt ausschied, übernahm sie im Mai 2002 die Leitung des Goethe-Instituts - ebenfalls als erste Frau. «Es ist das schönste Ehrenamt, das die Republik zu vergeben hat», sagt sie im Rückblick. Dabei musste sie von Anfang an immer härtere Kürzungen der deutschen Sprach- und Kulturförderung durch das Auswärtige Amt hinnehmen, dem das Goethe-Institut untersteht. Als nach der Schließung in Rothenburg ob der Tauber auch Häusern im europäischen Ausland das Aus drohte, kam die Wende. Steinmeier stockte den Etat wieder auf. Als «großartiges Ereignis für das Institut, nicht nur für mich persönlich» nennt Limbach als erstes die Eröffnung des Lesesaals in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang. Leidenschaft für die deutsche Sprache Ihr Nachfolger muss die angefangene Umstrukturierung samt Stellenabbau in der Münchner Zentrale fortsetzen. Und «ein lieb gewonnenes Kind», um das er sich mit gleicher Inbrunst kümmern möge, ist für Limbach «das Werben um die deutsche Sprache weltweit und als Europasprache». Mit anderen Organisationen hat sie den Deutschen Sprachrat ins Leben gerufen, um auch im Inland «die Freude an der deutschen Sprache zu beleben». Wirklich im Ruhestand ist Jutta Limbach auch nach dem 31. März nicht. Von Hochschulräten über die Kommission zur Rückführung jüdischer Kunstwerke bis zur Berliner Philharmonie ist sie weiter in vielen Ehrenämtern engagiert. Außerdem ist sie nicht nur begeisterte Romanleserin, sie schreibt auch. Ihr neuestes Buch heißt: «Hat die deutsche Sprache Zukunft?» und soll in Kürze erscheinen. Das Etikett Workaholic stimme schon, sagt sie fröhlich: «Ich bekomme sicher keine Langeweile. (Link) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Jena |
Dieser Beitrag wurde am 01.04.2008 um 17.41 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#3097 KMK-Pressemitteilung Bonn, 13.12.2007 Ergebnisse der 320. Plenarsitzung der Kultusministerkonferenz [...] Wahl der Präsidentin und des Präsidiums für das Jahr 2008 Mit Beginn des Jahres 2008 übernimmt die Ministerin für Bildung, Familie, Frauen und Kultur des Saarlandes, Frau Annegret Kramp-Karrenbauer, die Präsidentschaft der Kultusministerkonferenz. Die Präsidentschaftsübergabe findet am 16. Januar 2008 in Berlin statt. Zu Vizepräsidenten der Kultusministerkonferenz für das Jahr 2008 mit Sprecherfunktionen wurden gewählt: 1. Vizepräsident Minister Henry Tesch, Mecklenburg-Vorpommern (Sprecher für Schule), 2. Vizepräsident Staatsminister Dr. Thomas Goppel (Sprecher für Kultur), Bayern, 3. Vizepräsident Senator Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner (Sprecher für Hochschulen), Berlin. Staatsministerin Doris Ahnen (Rheinland-Pfalz) und Staatsministerin Karin Wolff (Hessen) gehören dem Präsidium der Kultusministerkonferenz als kooptierte Mitglieder an. |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Jena |
Dieser Beitrag wurde am 02.04.2008 um 15.12 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#3105 Hinweis: Dieser Beitrag ist weder neu noch eine Wiederholung, der eigentlich neue steht hier; wegen der Chronologie habe ich die eingetragenen Texte umsortiert. (Siehe dazu auch hier und, darauf aufbauend, hier.) KMK-Pressemitteilung Bonn, 08.12.2006 Ergebnisse der 321. Plenarsitzung der Kultusministerkonferenz am 6. März 2008 in Berlin [...] 5. Regelung der Führung ausländischer Doktorgrade Da es verschiedentlich zu Anzeigen wegen angeblich missbräuchlicher Führung von Doktorgraden gekommen ist, wird die Führung von ausländischen Doktorgraden neu geregelt: Inhaber des Doktorgrades „Doctor of Philosophy“ – Abk.:“Ph.D“ von Universitäten der sog. Carnegie-Liste der Vereinigten Staaten von Amerika können anstelle der im Herkunftsland zugelassenen oder nachweislich allgemein üblichen Abkürzung die Abkürzung „Dr.“ jeweils ohne fachlichen Zusatz und Herkunftsbezeichnung führen. Das Sekretariat der Kultusministerkonferenz wird beauftragt, hinsichtlich der Staaten, bei denen der Doktor-Titel ohne fachlichen Zusatz, jedoch mit Herkunftsbezeichnung geführt werden muss (Australien, Israel, Japan, Kanada, Russland), eine Liste von Hochschulen vorzulegen, bei denen analog verfahren werden kann. |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Halle (Saale) |
Dieser Beitrag wurde am 15.05.2008 um 19.44 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#3309 Lesen im Gehirn Röntgenkongress in Berlin: Radiologen fahnden nach Veränderungen im Kopf von Legasthenikern. Von Adelheid Müller-Lissner Manche Kinder tun sich mit dem Lesenlernen und der Rechtschreibung schwerer als ihre Altersgenossen, obwohl sie genauso intelligent sind und sich mindestens so viel Mühe geben wie die anderen. Inzwischen setzt sich die Erkenntnis durch, dass diese frustrierende Störung neurobiologische Grundlagen hat. Dazu hat zuletzt beigetragen, dass einige Gene identifiziert wurden, die bei Betroffenen verändert waren. Legasthenie ist längst als Krankheitsbild anerkannt, von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie gibt es eine Leitlinie, in der das fachlich fundierte Vorgehen in Diagnostik und Therapie beschrieben wird. Der Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie, in dem sich die Eltern betroffener Kinder zusammengetan haben, geht davon aus, dass vier von 100 Schülern eine Lese-Rechtschreib-Schwäche haben. Der Verband kritisiert aber auch seit Jahren, dass es mit der Anerkennung der Störung und der adäquaten Förderung in den Schulen nach wie vor hapert. Möglicherweise kann die moderne Bildgebung helfen, das zu ändern. Auf dem Deutschen Röntgenkongress, der in der vergangenen Woche in Berlin stattfand, wurde eine Studie vorgestellt, für die Kinderradiologen der Universität Jena 28 Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwäche und 21 Altersgenossen ohne diese Probleme mit einer besonderen Form der Magnetresonanztomographie (MRT) untersucht haben. Bei dem Verfahren namens Diffusion Tensor Imaging (DTI) wird die Beweglichkeit von Wassermolekülen im Gewebe gemessen. Errechnet werden ein Koeffizient für die Diffusion der Wassermoleküle und ein Faktor, der über ihre Ausrichtung Auskunft gibt. Das sind Anhaltspunkte für die Feinanatomie des Gehirns und geben Aufschluss darüber, wie die Nervenbahnen verlaufen, die verschiedene Hirnregionen verbinden und von der Hirnrinde aus in alle Bereiche des Körpers verlaufen. Die Methode wird heute schon zur Diagnose neurologischer Erkrankungen von Schlaganfall bis Multiple Sklerose eingesetzt. Nun konnten die Jenaer Mediziner um Hans-Joachim Mentzel, Oberarzt des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, zeigen, dass verschiedene Hirnstrukturen der Legasthenie-Kinder von denen anderer Kinder abwichen. Dass sich die Bilder nicht gleichen, ist keine ganz überraschende Erkenntnis. Aus Ableitungen von Hirnströmen im Elektroenzephalogramm weiß man, dass die zuständigen Areale bei Menschen mit Legasthenie andere Aktivierungsmuster zeigen. Strukturuntersuchungen ergaben zudem schon früher, dass der Balken, der beide Hirnhälften verbindet, bei ihnen weniger Volumen aufweisen kann. Mit einer anderen Art von MRT – der funktionellen MRT – wurde dem Gehirn von Kindern und Erwachsenen mit Lese-Rechtschreibschwäche außerdem schon bei der Arbeit zugeschaut. Es zeigte sich, dass die Betroffenen beim Lesen andere Muster der Beanspruchung von Gehirnarealen zeigen als Kontrollpersonen, die sich mit dem Lesen leichter taten. Während der Untersuchung an der Uni Jena, die die Radiologen in Zusammenarbeit mit den Kinder- und Jugendpsychiatern realisierten, sollten die Kinder allerdings nicht lesen oder schreiben. Die Forscher interessierten sich vielmehr für das Bild, das die Gehirne der Acht- bis 14-Jährigen im Ruhezustand abgaben. Zum Teil zeigten sich dort Werte, die auf eine höhere Beanspruchung der jeweiligen Region hinweisen, etwa in der „Corona radiata“, einem bestimmten Nervenbündel unterhalb der Hirnrinde. „Das lässt zumindest die Deutung zu, dass die Anstrengung beim Lesenlernen im Gehirn der Kinder mit Legasthenie Spuren hinterlassen hat“, sagt Mentzel. Er mahnt jedoch zur Vorsicht bei der Deutung der Befunde – die demnächst mit einem Gerät überprüft werden sollen, das dünnere Schichten abbildet und genauere Aussagen erlaubt. Die im Schnitt elf Jahre alten Kinder, deren Gehirne in Jena „gescannt“ wurden, hatten zuvor die Diagnose Legasthenie aufgrund der gängigen Kriterien bekommen. Sie waren aber noch nicht in spezielle Übungsprogramme aufgenommen. Nun interessieren sich die Kinderpsychiater dafür, welche Veränderungen sich in der Funktion und in der Struktur des Gehirns während und nach einer gezielten „Beübung“ zeigen werden. Wird es eher eine Angleichung der Strukturen oder ein weiteres Auseinanderdriften geben? Längsschnittuntersuchungen könnten helfen, wirksame von weniger wirkungsvollen Übungsprogrammen zu unterscheiden. „Es wäre schön, wenn man unsere Bilder nutzen könnte, um herauszufinden, welche Therapie beim einzelnen Kind die höchsten Erfolgschancen hat“, sagte Kinderradiologe Mentzel. Er hält es auch für möglich, dass die Bildgebung künftig als einer von mehreren Bausteinen bei der exakten Diagnosestellung verwendet werden könnte. Allerdings sind die Forscher heute von Referenzwerten, die „Gesunde“ sicher von Menschen mit Lese-Rechtschreib-Schwäche unterscheiden, noch weit entfernt. Die Vorstellung, dass eine MRT des Kopfes für alle Vorschulkinder bald genauso zu den Routine-Vorsorgeuntersuchungen gehören könnte wie das Messen und Wiegen, hält der Radiologe für abwegig. Und das nicht nur, weil die Bilder, für sich genommen, wenig Aussagekraft hätten. „Die ganz Kleinen würden sowieso nicht mitspielen, wenn man sie bittet, ein paar Minuten in einer solchen Röhre auszuhalten“. (Erschienen im gedruckten Tagesspiegel vom 13.05.2008) (Link) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Halle (Saale) |
Dieser Beitrag wurde am 20.05.2008 um 09.08 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#3338 Gelehrte Aufmerksamkeit für das ausgegrenzte Europa Die Deutsche Akademie hielt ihre Frühjahrstagung in Lemberg ab – und war entzückt Bei den Planungen für ihre Tagung in Lemberg mochte die Deutsche Akademie noch gedacht haben, den Ukrainern ein Geschenk zu bringen. Tatsächlich wurde die Akademie mit grosser Freude empfangen. Aber mit jedem Tag wurde klarer: Sie, die Gäste, waren die Beschenkten. Joachim Güntner Fremder, suchst du Europa, dann fahre nach Lemberg. Lass dich nicht irremachen durch eine EU-Osterweiterung, die so tut, als höre der europäische Kulturraum an der Ostgrenze Polens auf – als zähle die Ukraine nicht mehr dazu. Eine Mauer aus Visumspflichten hat das Schengener Abkommen zwischen diesen beiden traditionell verflochtenen Ländern gezogen, dabei das alte Galizien teilend. Ausgesperrt aus «der reichen, saturierten Hälfte Europas, die wir oft für das Ganze nehmen» (Martin Pollack), sind die Lemberger. Ihre Stadt, am Ende des 19. Jahrhunderts nach Wien, Budapest und Prag die viertgrösste Metropole des Habsburgerreiches, liegt jetzt erst recht im toten Winkel westlicher Wahrnehmung. Dabei ist Lemberg bis in seine Fundamente hinein europäisch. Betörendes Stadtbild Der westlichen Ignoranz trotzend, hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung ihre diesjährige Frühjahrstagung in Lemberg abgehalten, und Petrus verstand es, diese weise Entscheidung grosszügig zu honorieren. Ein gleissend blauer Himmel empfing die angereisten Akademiker, die Sonne schuf ein betörendes Spiel von Licht und Schatten auf den Renaissance- und Barockfassaden von Lembergs Altstadt. Unter den Markisen der Strassencafés sassen die Lemberger, die leidenschaftliche und verwöhnte Kaffeetrinker sind, und boten einen beinahe mediterranen Anblick. Die Kastanien, mit denen diese Stadt reich gesegnet ist, prangten im satten Grün und im blühenden Weiss ihrer Kerzen. Darunter, auf den zahlreichen Bänken, schmusende jugendliche Paare. Alle zehn Meter eine hübsche, augenfällig auf ein reizvolles Äusseres bedachte Frau. Verblüffend, dass fast niemand eine Brille trägt, es sei denn zum Schutz gegen die Sonne. Allerdings scheint es leider auch kaum Zeitungen zu geben, an denen sich die Leute die Augen verderben könnten. Lemberg, rund 800 000 Köpfe zählend, ist eine Vielvölkerstadt. Die Amtssprache ist Ukrainisch, Polnisch gilt als schwesterliches Idiom, Russisch hingegen hören die lokalen Patrioten gar nicht gern. Die Sehnsucht nach dem Westen ist gross, das Selbstbild galizisch, die Hauptstadt Kiew weckt Animositäten, und ginge es nach den Separatisten, könnte man ganz gut ohne die Ost-Ukrainer, diese «Barbaren», auskommen. Dass die östliche Hälfte des Landes nicht erst nach dem Zweiten, sondern schon nach dem Ersten Weltkrieg unter sowjetische Fuchtel geriet (und vorher ja schon an die zaristische Knute gewöhnt worden war), hat die mentale Spaltung des Landes stark befördert. Kommunismus dort, kakanische Lebensart hier. Die Sowjetzeit und die Ansiedlung von Bauern als Industriearbeiter haben der kultivierten Gemütlichkeit schwer zugesetzt. Heute lassen ihr die Härten des Alltags wenig Raum. Krasse Unterschiede zwischen Arm und Neureich sind augenfällig. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, Korruption normal, und die Mafia knüpft ihre Netze. Freilich blieb die Deutsche Akademie von solchen Bedrängnissen unbehelligt. Allenfalls, dass ein bestellter Sitzungssaal plötzlich anderweitig vergeben war, jedoch sorgte ein ukrainischer Theaterdirektor umgehend für Ersatz. Der Austausch mit den Germanisten der Universität Lemberg war rege, und als beglückend empfand man den Andrang der Studenten zu Veranstaltungen, wo etwa Peter Eisenberg über den Stand der deutschen Rechtschreibreform berichtete (Fazit: Vieles ist wieder beim Alten, und irgendwann wird der irritierte Schreiber wieder ohne den permanenten Griff zum Wörterbuch auskommen) und Heinrich Detering die Lage der germanistischen Literaturwissenschaft skizzierte, die er als von wechselnden Methoden und Moden sowohl gebeutelt wie befruchtet beschrieb. Beträchtliche Anforderungen an die Geduld der Zuhörer stellten die öffentlichen Lesungen mit ukrainischen und deutschen Schriftstellern. Dass jeder vorgetragene Text hinterher übersetzt werden musste, streckte die Veranstaltungen enorm. Als ein abendliches Dichterfest in der Lemberger Philharmonie mit sechs Poeten bereits für die erste Runde (mit Natalka Bilozerkiwez, Robert Schindel und Joseph Zoderer) zwei Stunden verschlang, fanden die nach der Pause folgenden Lesungen vor gelichteten Reihen statt. Aber viele hatten doch ausgeharrt. Und sie wurden belohnt. Mit Serhij Zhadans poppig-rappiger Suada geriet das «Fest» in Schwung, mit Jan Wagners präziser und stimmig gearbeiteter Lyrik gewann es an sprachkünstlerischer Klasse, und Viktor Neborak machte mit dem sinnlichen Sehnen seiner Poesie wett, was man an seinen Gedichten konventionell hätte nennen dürfen. Diese drei, Vertreter einer jüngeren Generation, retteten den Abend. Als dann zwei Tage später Christoph Ransmayr und Juri Andruchowytsch am selben Ort zur Lesung zusammentrafen, wiederholte sich die Sitzfleischstrapazierung der Anwesenden, so dass es erneut zu Abwanderungen und bissigen Kommentaren über die Art der Präsentation kam, dafür war jetzt der schwere rote Samtvorhang im Bühnenhintergrund aufgezogen und gab den Blick auf eine Orgel von barocker Opulenz frei. In summa: Als Lesung war das Ganze problematisch, an die Kulisse indes darf man sich noch lange erinnern. Gut geglückte Feierstunde Zwei ihrer alljährlich vergebenen Preise hatte die Akademie in Lemberg zu überreichen: Verena Reichel, von ihrem Laudator Lars Gustafsson auf das Charmanteste gepriesen, erhielt für ihre Übersetzung vor allem der schwedischen Gegenwartsliteratur ins Deutsche den Johann-Heinrich-Voss-Preis; der Friedrich-Gundolf-Preis ging an den Lemberger Essayisten und Übersetzer Jurko Prochasko, einen exzellenten Kenner und bei aller Jugend überaus gelehrten Liebhaber der deutschsprachigen Literatur und Philosophie. Martin Pollack hielt die Laudatio, die auch ein Ruhmesgesang auf Galizien war. Lässt man das mit Fehlleistungen behaftete Grusswort des aus Kiew angereisten deutschen Botschafters beiseite, so ist zu sagen: An dieser Preisverleihung bestachen sämtliche Reden durch Vorzüglichkeit. Keine war wie die andere, alle waren schön, am schönsten aber war diejenige Prochaskos, die diesen Kulturvermittler eben nicht als Mittler, sondern als eigenständige poetische Kraft von überraschender Potenz erwies. Jeder im Saal bemerkte das. Und als dann auch noch zum Abschluss Akademie-Präsident Klaus Reichert, menschenfreundlich engagiert wie stets, die Gunst der Stunde nutzte und den Botschafter um Abbau der bürokratischen Hindernisse im ukrainisch-deutschen Austausch und Reiseverkehr bat, entlud sich das Entzücken in frenetischem Beifall. Lemberg, das lässt sich sagen nach diesem Besuch der Deutschen Akademie und ihrer Begeisterung von der Stadt, hat nun einige Verehrer mehr. (NZZ, 20. Mai 2008) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Halle (Saale) |
Dieser Beitrag wurde am 04.06.2008 um 17.41 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#3446 Warum unsere Sprache verschlampt Von Wolfgang Herles Die deutsche Sprache verschludere nicht durch Jargon oder Denglisch, sie werde vielmehr von denen vernachlässigt, die Verantwortung für sie trügen, meint Wolfgang Herles, Leiter des ZDF-Kulturmagazins "aspekte". In der ersten Reihe der Politiker - ob Bundespräsident, Kanzlerin oder Oppositionsführer - sei niemand mit Sprachgefühl vertreten. "Hat Deutsch eine Zukunft?", fragt Jutta Limbach, die ehemalige Präsidentin des Goethe-Instituts und des Bundesverfassungsgerichts. Sie belebt mit ihrem kleinen Buch eine große, wenn auch und gewiss nicht neue Debatte. Das ist verdienstvoll. Limbachs politisch überaus korrekte Einerseits-Andererseits-Erörterung reduziert freilich die Problematik auf das Vordringen des Englischen, als ob dies die einzige Bedrohung für das Deutsche sei. Sie wittert "Sprachverrat". Im Übrigen, behauptet Frau Limbach, habe das Deutsche kein Qualitätsproblem. Alles "Verfallsgerede" sei sinnloses Gejammer. Damit aber redet die Autorin schön und lenkt ab von den wahren Feinden unserer Sprache. Das Englische gehört nicht zu ihnen. Das Deutsche wird auch nicht dadurch zur "Folkloresprache", wie Frau Limbach befürchtet, dass deutsche Wissenschaftler nur noch in Englisch lehren und publizieren. Der Siegeszug des Englischen als globalem Verständigungsmittel ist nun einmal nicht aufzuhalten. Besser müsste man sagen: Einer Art des Englischen. Davon nimmt übrigens das Hoch-Englisch den größten Schaden. Es wird ihm ergehen wie einst dem Lateinischen, das im Mittelalter verhunzt worden ist. Ohne eine moderne Lingua franca kann auch die Europäische Union auf Dauer nicht zu einer Gesellschaft zusammenwachsen. Das werden am Ende sogar die Franzosen einsehen müssen. Das Einsickern englischer Wörter und Sprachformen steht auf einem anderen Blatt. Es kann und sollte nicht verboten werden. Sprache entzieht sich staatlicher Reglementierung. Sie ist lebendig, ständig im Fluss, und sie ist frei. Wo sie es nicht ist, sind es auch die Menschen nicht. Bedeutend größer als die englische Gefahr ist die Geringschätzung, die das Deutsche durch Deutsche selbst erfährt. Unsere Sprache verschlampt. Sie verschludert nicht durch die Jargons der Straße, nicht durch Kanakisch und nicht durch Denglisch. Vernachlässigt wird die Sprache von denen, die Verantwortung für sie tragen, ob sie wollen oder nicht, weil sie Vorbilder sind, im Guten wie im Schlechten. Besonders grauenhaft ist die Sprache der Politik. Die Kunst der Rede ist verkommen, in den Parlamenten, in den Parteien, in den Talkshows. Vom Bundespräsidenten über die Kanzlerin bis zum Oppositionsführer: Zumindest in der ersten Reihe ist kein Spitzenpolitiker mit Sprachgefühl zu entdecken. (Und offenbar auch kein Ghostwriter.) Von Leidenschaft für Genauigkeit, Anschaulichkeit, Vielfalt, Eleganz, Sprachwitz, Frische keine Spur. Ja, wir müssen uns wehmütig an Helmut Schmidt, Franz Josef Strauß, Herbert Wehner, Richard von Weizsäcker und inzwischen auch an Joschka Fischer erinnern. Es ist ein schlechter Witz, dass ausgerechnet Politiker glauben wollten, mit einer Rechtschreibreform das Deutsche voranbringen zu können. Sie haben sie versemmelt und ein Chaos in Schülerköpfen angerichtet. Zugegeben: Ich sitze im Glashaus. Die Sprache der Medien ist kaum ein größerer Genuss als die Sprache der Politik. Die Unkultur der Talkshows führt dazu, dass nur noch unfrisiert dahergeschwafelt und -gequatscht wird. Trotz Akademisierung des Berufsstands ist auch die Sprache des Journalismus nicht besser geworden. Woran das liegt? Längst vorbei sind die Zeiten, in denen in den Rundfunksanstalten professionelle Sprachpfleger und in den Zeitungen Korrektoren beschäftigt worden sind. Selbst in den meisten Buchverlagen sind die Qualitätsstandards für gute Sprache gesunken. Die Verschlampung der Sprache macht auch vor den Kulturproduzenten nicht halt. Woran das liegt? Es kommt nur noch auf Auflage und Quote an. Schnelligkeit schlägt Schönheit. Der Populismus siegt auch in den Medien. Nicht nur die Boulevardpresse schmeißt sich mit verkommener Sprache dem Publikum an den Hals. Bloß keinen Zuschauer, keinen Leser mit so etwas wie Stil überfordern! Die Beliebtheit des Sprachkolumnisten Bastian Sick ist mit der Popularität von Fernsehköchen vergleichbar. Sie sind Entertainer. Und selbst die Überdosis von Kochshows hat nicht dazu geführt, dass die Deutschen besser kochen und sich qualitätsbewusster ernähren. Vergessen wir nicht die Eliten der Wirtschaft. All die Spitzenverdiener! Sie reden, als hätten sie ihre Ausdruckskraft in den Unterrichtsfächern Werken und Technisch Zeichnen erworben. Sie sind gerade noch in der Lage, ihre Power-Point-Präsentationen zu betexten, ob auf Englisch oder Deutsch macht da keinen Unterschied mehr. Nur mitreißend Reden können sie nicht, weil Sprachgefühl offenbar nichts mehr ist, was für eine Karriere zwingend erforderlich scheint. Gutes Deutsch gilt offensichtlich schon an Elitehochschulen als ausgesprochen uncool. Das ist der Kern des Problems. Wolfgang Herles, Publizist und Journalist, studierte Neuere deutsche Literatur, Geschichte und Psychologie in München. Nach seiner Promotion 1980 und dem Besuch der Deutschen Journalistenschule war er zunächst Korrespondent für den Bayerischen Rundfunk in Bonn und Redakteur des TV-Magazins "Report". Von 1987 an leitete er das ZDF-Studio Bonn und moderierte später auch die ZDF-Talkshow "Live". Er ist jetzt Leiter des ZDF-Kulturmagazins "aspekte". (Link) |
| nach oben | |
|
Christoph Schatte Poznan |
Dieser Beitrag wurde am 05.06.2008 um 21.04 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#3454 Im von Jan-Martin Wagner zugänglich gemachten Artikel von Wolfgang Herles steht in einem Absatz zu lesen: "Bedeutend größer als die englische Gefahr ist die Geringschätzung, die das Deutsche durch Deutsche selbst erfährt. Unsere Sprache verschlampt. Sie verschludert nicht durch die Jargons der Straße, nicht durch Kanakisch und nicht durch Denglisch. Vernachlässigt wird die Sprache von denen, die Verantwortung für sie tragen, ob sie wollen oder nicht, weil sie Vorbilder sind, im Guten wie im Schlechten." Dem ist nichts hinzuzufügen, und viel deutlicher geht es wohl auch nicht. Das Problem indessen ist, daß sowohl das Wort Verantwortung als auch der Begriff den deutschen Sprachteilhabern seit nunmehr vierzig Jahren – wie man sieht – höchst erfolgreich aus dem Kopf gewaschen wird. In ein paar Jahren also wird dieser Textabschnitt z.B. Gymnasiasten von einem Sprachhistoriker erklärt werden müssen, weil dann niemand mehr nachzuvollziehen vermag, worum es dem Autor ging. In diesen bald anhebenden glücklichen Tagen werden nur noch deutsche Texte entstehen, in denen das Wort Verantwortung generell durch das Wort Anspruch ersetzbar sein wird, ohne jegliche Kontext- oder andere Sensitivität. |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Halle (Saale) |
Dieser Beitrag wurde am 10.06.2008 um 16.17 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#3469 Wer nicht zuhört, macht Fehler Während sich Experten über die richtige Therapie bei Legasthenie streiten, steigt die Zahl der betroffenen Kinder. Schuld ist auch die Sprachverarmung in Familien Von Birgitta vom Lehn Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) leiden oft an Störungen der Lautverarbeitung. Das heißt: Sie haben zwar ein einwandfrei funktionierendes Gehör, doch in schwierigen Hörsituationen wie großen Klassenräumen benötigen sie sehr viel kognitive Kapazität, was zu Fehlern bei der Rechtschreibung führt. Die Kinder können dann einzelne Laute nicht den Buchstaben zuordnen, verdrehen oder vergessen sie. Konkrete Angaben zur Häufigkeit solcher Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen liegen bisher nicht vor. "Die langen Wartelisten für die pädaudiologische Diagnostik von Kindern mit Verdacht darauf zeigen jedoch, wie schwerwiegend sich das Problem gegenwärtig darstellt", betont Psychologin Maria Klatte von der Universität Oldenburg. Auch Erzieherinnen, Grundschullehrerinnen und Ärztinnen, die mit der Schuleingangsuntersuchung befasst sind, bestätigten diesen Eindruck, sagt Klatte: Sie berichteten über die wachsende Zahl von Kindern "mit gravierenden Zuhörproblemen" und sprachlichen Auffälligkeiten. Als Ursachen kommen zum einen medizinische Faktoren wie Hirnreifungsverzögerungen, frühkindliche Hirnschädigungen und häufige Mittelohrentzündungen in der frühen Kindheit infrage. Daneben spielen mangelnde Zuhör- und Sprachanregungen eine Rolle: In den Familien wird immer weniger gesprochen. Auch Fernsehkonsum von mehr als zwei Stunden täglich bereitet der LRS den Boden. LRS-Kindern wird vielfach ein spezielles Hörtraining empfohlen. Allerdings streiten die Experten, was besser ist: ein umfassendes Programm mit Sprachspielen und phonologischen Lautübungen oder ein Training mit Computer. Fred Warnke aus Wedemark bei Hannover ist Erfinder des elektronischen Trainingsgeräts "Brain-Boy" (Hirn-Junge). 25 Jahre hat er bei der Akustikfirma Sennheiser gearbeitet und sich dort mit Medizintechnik für Schwerhörige befasst. Bis sich der vierfache Familienvater selbstständig machte. 25 000 Brain Boys seien zurzeit im Einsatz, sagt Warnke. Der Psychologe Professor Uwe Tewes von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) hat Warnkes Methode evaluiert und kam zu dem Schluss: "Damit ist erstmals der Nachweis erbracht, dass dieses Training die Leistungen in der zentralen Verarbeitung verbessert und zudem einen Transfer auf die Rechtschreibleistungen bewirkt." Deshalb sagt Warnke jetzt: "Mein Verfahren kann als einziges auf schlüssige Erfolge verweisen." Eine neue Studie, publiziert in der Zeitschrift "Klinische Pädiatrie", hegt nun aber Zweifel am Erfolg der Trainingscomputer: Es gebe keine Zusammenhänge zwischen Unterschieden in basaler auditorischer Verarbeitung und Rechtschreibung, so das Fazit. "Durch die Vielzahl in- und ausländischer Hörtrainingsverfahren, die quasi ,kaufbare Medizin' darstellen, wird Hoffnung auf schnelle Hilfe bei Legasthenie suggeriert. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese Rechnung nicht aufgeht", sagt Professor Martin Ptok, Ärztlicher Direktor der Klinik für Phoniatrie und Pädaudiologie an der MHH. Ptok hat in einer als repräsentativ geltenden Querschnittsuntersuchung bei 200 Kindern der dritten und vierten Grundschulklasse mittels fünf verschiedener Tests Aspekte der basalen beziehungsweise schnellen auditorischen Verarbeitung gemessen und die Ergebnisse mit den Noten der Kinder in Rechtschreibung, Deutsch und Mathematik verglichen. 18 Prozent der Kinder zeigten bei den Hörtests auffällige, sprich zu niedrige Werte. Davon hatte aber ein Kind sogar die Note Eins in Rechtschreibung, acht Kinder hatten eine Zwei, 14 Kinder eine Drei, sieben eine Vier, und nur zwei hatten die Note Fünf. Umgekehrt fiel auf, dass einige Kinder, die in Rechtschreibung eine Fünf hatten, bei den Hörtests gute oder sogar überdurchschnittlich gute Ergebnisse erzielten. Ptok: "Insgesamt muss man aufgrund dieser Daten den Zusammenhang zwischen basalen auditorischen Fähigkeiten und Rechtschreibleistungen eher skeptisch betrachten." Für die Praxis bedeute dies, "dass vor dem unkritischen Einsatz von Trainingsgeräten zur Verbesserung basaler auditorischer Funktionen zu warnen ist". Warnke wirft der Ptok-Studie "methodische Fehler" vor: Es seien dort mit einem anderen Gerät zu wenige Funktionen gemessen worden. Den visuellen und motorischen Kanal habe man völlig ignoriert, dabei biete gerade sein Gerät ein "ganzheitliches Konzept". Der Streit um die beste LRS-Trainingsmethode geht also weiter. (Die Welt, 1. Juni 2008) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Halle (Saale) |
Dieser Beitrag wurde am 28.06.2008 um 08.04 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#3538 Rhein-Zeitung online, 25. Juni 2008 Polizei-Bewerber scheitern oft an Rechtschreibung Lautzenhausen. Bewerber für den rheinland-pfälzischen Polizeidienst scheitern nach Beobachtungen der Landespolizeischule vor allem an ihren mangelhaften Rechtschreibkenntnissen. Das Diktat sei «für Etliche eine erhebliche Hürde», sagte die an dem Auswahlverfahren beteiligte Diplom-Psychologin, Christine Telser, in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur dpa in Koblenz. Zudem sei zu beobachten, dass immer mehr Bewerber im Auswahlverfahren Probleme hätten, über Hindernisse zu klettern oder Purzelbäume zu schlagen. http://rhein-zeitung.de/on/08/06/25/rlp/t/rzo440969.html |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Halle (Saale) |
Dieser Beitrag wurde am 03.07.2008 um 11.20 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#3555 Broschüre „Korrekturzeichen nach DIN 16 511“ Die Fortschritte in der Computertechnologie haben Satz, Grafik und Layout von Drucksachen immens vereinfacht. Aber: Die „Generation SMS“, die misslungene Rechtschreibreform und nicht zuletzt die immer stärkere Verbreitung des „Denglisch“ führen dazu, dass viele Drucksachen und Webseiten in zweifelhaftem Deutsch daherkommen. Auch der gestiegene Kostendruck führt bei vielen Anwendern dazu, dass das geschriebene Wort vor der Veröffentlichung nicht mehr professionell auf Fehler hin gelesen wird. Dabei ist eine klare, verständliche und vor allem fehlerfreie Sprache mindestens genauso wichtig wie ein gutes Layout. Etwas in Vergessenheit geraten ist in vielen Fällen auch die korrekte Anwendung der Korrekturzeichen. Um Abläufe verständlich und nachvollziehbar zu gestalten und unnötige Nachfragen zu vermeiden, ist die Verwendung eindeutiger Zeichen allerdings unbedingt vonnöten. Die Schulungsfirma Cleverprinting stellt auf ihrer Webseite allen Interessenten eine kostenlose PDF-Broschüre zum Thema Korrekturzeichen zur Verfügung. Auf insgesamt acht Seiten erklärt der Typografie-Experte Günter Schuler, welche Korrekturzeichen es gibt und wie sie richtig angewendet werden. Die Broschüre steht als druckbares PDF zum kostenlosen Download in zwei verschiedenen Versionen zur Verfügung. von Johannes Wilwerding http://docma.info/Broschuere-Korrektu.4889.0.html |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Halle (Saale) |
Dieser Beitrag wurde am 18.07.2008 um 17.51 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#3622 Rheinischer Merkur, 17. Juli 2008 LEOPOLDINA / Chance für Deutschland – Halles Akademie ist das nationale Haus des Wissens Erste unter Gleichen Kein Recht auf Fehler: Wen 1300 Forscher beraten, der darf nicht mehr irren. VON HANS-JOACHIM NEUBAUER Kultur ist Ländersache. Wie in Stein gemeißelt, prägt dieser Rechtsgrundsatz den Umgang mit Bildung, Wissen und Forschen in Deutschland. Nicht nur zum Besten der Bürger. Die Debatte um die Rechtschreibreform und, erst kürzlich, die Diskussion um die achtjährige Gymnasialzeit haben gezeigt, wie anfällig der kulturelle Föderalismus dafür ist, Entscheidungen von nationaler Tragweite im Zwielicht der Hintergrundgremien nach Maßgabe des Mittelmaßes zu treffen. Gut, dass nun eine Bresche in die eng gefügte Mauer aus föderal motivierten Eitelkeiten und Zuständigkeiten gebrochen wurde: Halles Leopoldina, die älteste naturwissenschaftliche Akademie Europas, ist Nationale Akademie der Wissenschaften. Lange wurde um diesen Beschluss gestritten. Denn nicht nur in den jeweiligen Ländern genießen die deutschen Akademien einen guten Ruf: Auch international müssen sie keinen Vergleich scheuen. Kein Wunder, dass sie aufmerkten, als sich Bundesforschungsministerin Annette Schavan im vergangenen Jahr auf die Suche nach einer Prima inter Pares machte. Gemeinsam mit den Forschungsministern der Länder ernannte Schavan jetzt die fast 1300 internationalen Leopoldiner, unter ihnen 33 Nobelpreisträger, zu Beratern des Bundes. Bei ihren neuen Aufgaben werden die geehrten Gelehrten von ihren berlin-brandenburgischen Kollegen sowie von der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften in München unterstützt. Eine gute, eine nötige Entscheidung, denn es geht ums Ganze. Ohne klugen Rat kann niemand über Klima und Energie, über Gesundheit und Bildung befinden. Horst Köhler lobte die Unabhängigkeit der Leopoldina in DDR-Zeiten. Wenn diese Autonomie auch in der engeren Bindung an den Bund erhalten bleibt, ist das Votum für Halle keines gegen die Länder, sondern eines für die Bürger. Die Politiker sind in der Pflicht: Wen die Leopoldina berät, der hat kein Recht auf Irrtum mehr. http://www.merkur.de/2008_29_polkom_03.29146.0.html |
| nach oben | |
|
Michael Krutzke Bremen |
Dieser Beitrag wurde am 23.07.2008 um 15.08 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#3648 NDR Kultur - Wickerts Bücher Am 4. November 2007 ist die deutsch-amerikanische Schriftstellerin Irene Dische zu Gast bei Ulrich Wickert. Sie berichtet unter anderem über eigene Erfahrungen mit dem Zensur-Potential der political corrrectness in den USA. In diesem Zusammenhang macht sie eine interessante Aussage [kleine grammatische Korrekturen von mir, I.D. ist engl. Muttersprachlerin]: Ich finde, Deutschland ist nicht so geplagt wie Amerika von dieser Wortsauberkeit .Ich glaube hier in Deutschland geht es mehr um die Schreibkorrektheit, das finde ich ja auch albern. Wickert fragt nach und kommt dann darauf, daß Dische die RSR meint. Das Thema wird nicht vertieft, aber das tiefe Unverständnis der Autorin für diesen Unsinn und die passende Einordnung in den Bereich der Zensur wird deutlich. Das gesamte Interview ist nachzuhören im Podcast-Angebot von NDR Kultur. http://www.ndrkultur.de/service/podcast/ndr2234.html |
| nach oben | |
|
Karin Pfeiffer-Stolz Düren |
Dieser Beitrag wurde am 29.07.2008 um 22.57 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#3690 Auf, in den Uhrlaub. Oder Ualaup? So schreibt wohl ein Erstkläßler, wenn er die Anlauttabelle nach Reichen (ein „Pädagoge“) benutzt. Solche Methoden sind seit Jahren beliebt und sorgen neben der BeREICHerung des Erfinders dafür, daß Nachhilfeinstituten im Fach „Rechtschreiben“ der Nachwuchs massenweise zugeführt wird, und das bei zurückgehenden Schülerzahlen. Man hat also allen Grund, Herrn Reichen für seine fundamental umwälzende Erfindung in Sachen Lesen- und Schreibenlernen dankbar zu sein. Mein Urlaub: ist er wohl verdient? Woll, sagt der Sauerländer. Und das an allen möglichen passenden und unpassenden Stellen. Aber „wollverdient“ will er nun auch nicht sein, mein Urlaub. Allen Freunden der aufrechten Orthographie wünsche ich einen sonnigen August und entfleuche auf zwei Rädern hurtig aus dem deutschen Sprachraum. |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Halle (Saale) |
Dieser Beitrag wurde am 07.12.2008 um 22.32 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#4327 www.chip.de, 25. 11. 2008: GEZ-Gebühr für Internet-PCs vor dem Aus? Schwerer Schlag für die GEZ: Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hat in einem Urteil die Gebührenpflicht für gewerblich genutzte Internet-PCs grundsätzlich in Frage gestellt. Das Gericht sieht keine Rechtsgrundlage, die die Erhebung von Rundfunkgebühren für gewerblich genutzte Internet-PCs rechtfertigt. Nach Auffassung des Gerichts fallen so genutzte Computer nicht in die Kategorie der "neuartigen Rundfunkempfangsgeräte" für die eine Gebührenpflicht besteht. Ein "vernünftiger Durchschnittsbürger" verstehe unter dem Begriff Geräte, deren primärer oder mindestens sekundärer Zweck der Empfang von Fernseh- oder Radiosignalen sei. Ein PC, insbesondere ein gewerblich genutzter, falle nicht unter diese Definition. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden ist bereits das zweite Gericht, das entsprechend urteilt. Anfang Oktober gab das Verwaltungsgericht Münster einem klagenden Studenten recht, der argumentierte, er nutze seinen Computer lediglich im Rahmen des Studiums, nicht jedoch zum Rundfunkempfang. Beide Gerichte beriefen sich in ihren Urteilen auf die ARD/ZDF-Onlinestudie, die ermittelte, dass lediglich 3 bis 4 Prozent der Internetnutzer ihren PC als Radio oder Fernseher nutzen. Experten gehen nun davon aus, dass die Gebühr für Internet-PC erneut einer Prüfung unterzogen werden wird. (Link) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Halle (Saale) |
Dieser Beitrag wurde am 11.05.2009 um 17.58 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#4948 Intensives Werben für ein Orthografikum in Schleiz Otto Pätzold bittet Stadt um Unterstützung Schleiz (OTZ/-dre-). "Ein Orthografikum könnte neben dem Rennen ein Standbein für die Stadt Schleiz sein." Mit diesem Gedanken warb Hotelier Otto Pätzold am vergangenen Donnerstag nach dem Vortrag des Sprachwissenschaftlers Prof. Dr. Rudolf Hoberg (Lokalseite 2) im Feuerwehrgerätehaus um Unterstützung für ein Projekt, das im Geschichts- und Heimatverein offenbar schon eine feste Größe für die Zukunft geworden ist. Pätzold hat die Vision seines Orthografikums an das Mathematikum in Gießen angelehnt, das immer jährlich rund 150 000 zahlende Besucher aufweisen kann, die zum Eintritt von 6 Euro Mathematik sehr anschaulich erleben können. "Warum soll es eine Einrichtung, die sich der deutschen Sprache widmet, nicht in der Stadt des ersten Dudens geben", fragte Pätzold. Inzwischen war der Geschichts- und Heimatverein nicht untägig. Man verteilte das Konzept an die Mitglieder des Schleizer Stadtrates, an Abgeordnete des Kreistages, schrieb an die Landesregierung und den Landrat, von dem auch "ein positives wohlwollendes Echo kam", so Pätzold. Anfang des Jahres wurde nun eine Arbeitsgruppe "Orthografikum" im Geschichts- und Heimatverein gegründet, der Dr. Manfred Eckstein vorsteht. Als Mitstreiter konnte auch Dr. Rainer Pätzold aus Tanna gewonnen werden, der Experte in Dialektforschung ist. Die Arbeitsgruppe besuchte das Historische Museum in Berlin (OTZ berichtete) und es besteht nach Pätzolds Worten die vielleicht einmalige Chance, über einen Dauerleihvertrag einen großen Teil der Ausstellung zur deutschen Sprache inklusive der Medienstationen nach Schleiz zu holen. Otto Pätzold warb nun im Auftrag seiner Mitstreiter insbesondere bei Bürgermeisterin Heidemarie Walther und beim Landrat um Unterstützung für das Projekt "Orthografikum Schleiz". "Es ist eine gute Möglichkeit für unsere Stadt und für den Landkreis, die von Duden ausgehenden Traditionen und Impulse fortzuführen, sie zu nutzen, um die Wertstellung unserer Stadt nach innen und außen sowie ihren Bekanntheitsgrad deutschlandweit wesentlich zu erhöhen." Der Geschichts- und Heimatverein sucht gleichfalls Mitstreiter, die am Aufbau eines Hauses zur Pflege der deutschen Sprache mitarbeiten wollen. (Ostthüringer Zeitung, 11. Mai 2009) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Halle (Saale) |
Dieser Beitrag wurde am 16.05.2009 um 18.13 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#4966 Adolf Muschg, der "Vorbild-Intellektuelle", ist 75 Bundesrat Moritz Leuenberger lobte den Zürcher Schriftsteller und Literaturwissenschafter Adolf Muschg einmal als "die Stimme der denkenden Minderheit". Und in Deutschland gilt Muschg als weltoffener, kritischer Vorbild-Intellektueller. Einige deutsche Medien sehen ihn sogar als Nobelpreis-Anwärter. Von Zeit Online gefragt, ob er noch auf den Nobelpreis hoffe, antwortete Muschg vieldeutig: "Wer auf den wartet, verdirbt sich nur die Zeit". Orakel wie diese sind sonst gar nicht Muschgs Ding. Im Gegenteil äussert er sich stets dezidiert und oft mit markigen Worten zu gesellschaftlichen und politischen Fragen. Vor den Wahlen 2007 bemängelte er beispielsweise den "hoffentlich einzigartigen Tiefstand politischer Kultur". Muschg sei ein "Füllhorn der Zuständigkeiten", sagte Bundesrat Leuenberger in der bereits zitierten Rede zu Muschgs 70. Geburtstag vor fünf Jahren: Der Autor war unter anderem Mitbegründer der "Gruppe Olten", kandidierte Mitte der Siebziger für den Ständerat und arbeitete an der Totalrevision der Bundesverfassung mit. Mehrfach ausgezeichnet Muschg veröffentlichte Romane, Erzählungen, Biografien, Essays, Hörspiele, Drehbücher und Theaterstücke. Er erhielt nahezu alle bedeutenden deutschsprachigen Literaturpreise, darunter 1994 den wichtigsten, den Georg-Büchner-Preis. Schon sein literarisches Debüt "Im Sommer des Hasen" (1965) fiel durch kompositorische und stilistische Artistik auf. Meist aber wirken in seinen bisher über 30 Werken akademische, politische und literarische Erfahrungen und Anliegen zusammen. So etwa 1974 im Roman "Albissers Grund", in dem ein Gymnasiallehrer, wie Muschg selber einer war, seinen Psychiater erschiesst, was dem Autor Gelegenheit gibt, zwei 68er-Biografien aufzurollen. Auch in seinem Opus Magnum "Der rote Ritter" (1993), in dem er die Geschichte vom Gralsucher Parzival neu erzählt, findet seine Dreifachbegabung auf brillante Weise zur Einheit. Irritationen und Fluchten In letzter Zeit irritierte Muschg die Öffentlichkeit öfter einmal mit persönlichen Protestaktionen. So stieg er letztes Jahr als Finalist für den Schweizer Buchpreis erst am Vortag der Verleihung aus dem Wettbewerb aus. Böse Zungen warfen ihm nachher vor, er habe nur vorsorglich der Demütigung einer Niederlage entgehen wollen. Zwei weitere "Fluchten" machten Schlagzeilen: Im Dezember 2005 gab er sein Amt als Präsident der Berliner Akademie der Künste wegen "unüberbrückbaren Differenzen mit dem Senat der Akademie" ab. Er sah seine Forderung, Künstler sollten sich politisch stärker einmischen, von der Akademie nicht hinreichend mitgetragen. Im Februar 2009 schliesslich erklärte Muschg nach 35 Jahren das Ende seiner Zusammenarbeit mit dem Suhrkamp Verlag und seinen Wechsel zum Verlag C. H. Beck. Als Stiftungsrat warf er der Suhrkamp-Verlegerin Ulla Unseld-Berkéwicz Eigenmächtigkeit vor. Dass er seine privilegierten Stellungen als Suhrkamp-Autor und Akademie-Präsident scheinbar schmerzlos aufgab, erklärt sich möglicherweise mit dem Alter: "Das Schöne am Älterwerden ist, dass man nichts mehr werden muss", wie er es kürzlich formulierte. Irene Widmer, sda/swissinfo.ch (swissinfo.ch, 13. Mai 2009) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Halle (Saale) |
Dieser Beitrag wurde am 07.07.2009 um 18.59 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#5139 St. Galler Tagblatt, 30. Juni 2009 Gottlieb F. Höpli – Der Anchorman geht Seit 1994 war Gottlieb F. Höpli Chefredaktor des St.Galler Tagblatts. Vor drei Monaten hat er die Chefredaktion an Philipp Landmark übergeben, und heute hat er seinen letzten Arbeitstag. HANS-PETER KLAUSER Vor drei Monaten hat Gottlieb F. Höpli seinem Nachfolger Philipp Landmark den Stab der Chefredaktion übergeben, und heute verlässt er nun das Tagblatt endgültig. Entgegen dem Trend nicht vorzeitig, sondern ein Jahr nach seinem ordentlichen Pensionierungsalter. Das sagt wohl einiges aus über seine Bedeutung für unsere Zeitung und die Tagblatt Medien insgesamt. 1994 von der grossen NZZ kommend wurde er zu Beginn allerdings mit einem Schuss Zurückhaltung aufgenommen, so wie man es von guten Journalisten und echten Ostschweizern erwartet. Da half auch nichts, dass er tiefe Wurzeln im thurgauischen Wängi hat und einen unverkennbaren Thurgauer Dialekt spricht. Sein Germanistikstudium an der Uni Zürich, seine zehn Jahre als freier Journalist und seine siebzehn Jahre in der Inlandredaktion der NZZ liessen ihn irgendwie nicht mehr als «Eigengewächs» erscheinen. Das hat ihn allerdings nie gestört, so wie er sich als mutiger und unabhängiger Journalist im Lauf der Jahre überhaupt eine dicke Haut zulegen musste. Viel wichtiger aber war, dass er schon bald einmal begann, unserer Zeitung mit Taten und Worten das eigene Gepräge zu geben, seine Akzente zu setzen und seine Visionen zu verwirklichen. Das tat er nie allein, sondern immer nach ausführlichen Gesprächen mit seinem Umfeld und – was ihn als promovierter Germanist besonders auszeichnete – auch unter Berücksichtigung ökonomischer Gesetzmässigkeiten. In seinen fünfzehn Jahren als Chefredaktor hat er unsere Zeitung dreimal einer grösseren Blattrenovation unterzogen. Die erste beim grossen Ostschweizer Zeitungszusammenschluss 1998, bei der auch der Zeitungskopf in Frakturschrift verschwand, die zweite 2002 mit der Inbetriebnahme des neuen Druckzentrums in Winkeln, das dank modernster Technologie neue Möglichkeiten eröffnete, und die dritte im vergangenen Jahr, bei der mit der Schaffung eines sogenannten Newsdesk auch strukturelle Veränderungen in der redaktionellen Organisation eingeleitet wurden. Draht zu jungen Leuten Jedesmal ging es darum, den Veränderungen der gesellschaftlichen Bedürfnisse Rechnung zu tragen, den Zeitgeist noch besser zu widerspiegeln und neue Trends aufzunehmen. Dabei ist gfh. sein besonderer Draht zu jungen Leuten sehr zu Hilfe gekommen, und er hat mehr als einmal Ideen von Volontären, Praktikanten und Jugendmerkern aufgenommen. Überhaupt, mit den von ihm eingesetzten Merkern und zahlreich im Blatt veröffentlichten Antworten auf Leserbriefe hat er sich gerne der öffentlichen Kritik ausgesetzt und versucht, dem Leser journalistische Grundsätze und das Zeitungsmachen näherzubringen. Das war auch das Ziel seiner Aktivitäten an der Universität St. Gallen, wo er nicht nur den Gedankenaustausch mit Professoren pflegte, sondern in der Startwoche mit Studierenden auch eine eigene Zeitung machte. Ein strategisches Ziel unseres Medienunternehmens heisst Anspruch auf Themenführerschaft. Das bedeutet, dass es uns gelingen muss, jene Themen zu finden und zu setzen, die die Leute unserer Region interessieren, die für die öffentliche Diskussion und Meinungsbildung wichtig sind und über den Tag hinaus aktuell bleiben. Dafür hatte gfh. ein besonders gutes Gespür, wovon zahlreiche pointierte Kommentare, Kolumnen, Salzkörner, aber auch öffentliche Anlässe zeugen. Unvergessen bleibt sein Auftritt als Moderator in der geschichtsträchtigen Figur von Johann Konrad Kern anlässlich des Jubiläums 150 Jahre Eidgenossenschaft. Oder die Gegenveranstaltung im Theaterfoyer, als die öffentliche Lesung von «Fräulein Stark» von Thomas Hürlimann abgesetzt wurde. Die Dramatik des Moments Eine Zeitung am Kiosk verkaufen lässt sich unter anderem mit guten Schlagzeilen und entsprechenden Plakaten. Fast die Hälfte dieser Kioskplakate hat der scheidende Chefredaktor selber formuliert, das vielleicht trefflichste, als der FC St. Gallen ganz knapp die nächste Runde im Europacup verpasste mit der Affiche «die verfl… 92. Minute». Er, der noch nie an einem Fussballspiel war, hat es auch hier verstanden, die Dramatik des Moments unsern Lesern schmackhaft zu machen. Nicht nur die Sprache war ihm ein grosses Anliegen, sondern ebenso die über Jahre ins Kreuzfeuer der Kritik geratene Rechtschreibung. Als Mitbegründer der Schweizer Orthographischen Konferenz hat er mitgeholfen, die zeitweise chaotischen Verhältnisse in der Rechtschreibereform wieder auf den Pfad der Tugend zu bringen und für unsere Zeitung ein verbindliches Vademecum zu schaffen. Schliesslich hat er auch ein Herz für die Benachteiligten in der Ostschweiz bewiesen. Die von der «Neuen Luzerner Zeitung» schon seit vielen Jahren betriebene Weihnachtsaktion hat er auf unsere Verhältnisse übertragen und den Verein Ostschweizer helfen Ostschweizern ins Leben gerufen. «OhO» übertrifft inzwischen frühere Spendenaktionen unserer Zeitung um ein Mehrfaches. Gottlieb F. Höpli hat sich über die Jahre seines Wirkens zu einem eigentlichen Anchorman des Tagblatts entwickelt. Ein Begriff, der eigentlich aus dem Fernsehen stammt und zum Ausdruck bringt, dass eine Person, die eine Sendung moderiert, ordnet und ihr die Verankerung beim Publikum gibt, zur Marke für deren Inhalt wird. Mit seinem grossen Engagement und seiner Leidenschaft für unsere Zeitung hat er dies geschafft. Dafür danken wir ihm herzlich und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Hans-Peter Klauser Gesamtleiter Tagblatt Medien www.tagblatt.ch |
| nach oben | |
|
(Red.) |
Dieser Beitrag wurde am 11.07.2009 um 22.12 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#5156 Pressemitteilung [24. Juni 2009] Oberlandesgericht entscheidet: Sütterlinschrift im Verkehr mit Behörden zulässig Das Oberlandesgericht (OLG) Celle hat in einem Urteil festgestellt, dass es keine verbindlichen Vorschriften darüber gibt, welche Schriftart im Schriftverkehr zu verwenden ist. In einem spektakulären Fall, über den die Medien in der letzten Woche berichtet haben, wurde eine Behörde (die Justizvollzugsanstalt Celle) verurteilt, einen Bürger (hier einen dort einsitzenden Häftling) nicht deshalb zu benachteiligen, weil er im Schriftverkehr mit seiner Verlobten die Sütterlinschrift verwendet und dafür der Behörde der Kontrollaufwand zu hoch erscheint. Die Sütterlinschrift sei weder eine Geheimschrift, noch unlesbar oder unverständlich, wie die Behörde behauptet hatte. Dadurch, dass bis in die 90er Jahre die Sütterlinschrift bzw. Deutsche Schreibschrift als weitere Schriftart zumindest im Leseunterricht der bundesdeutschen Schulen verwendet wurde, können diese noch in weiten Teilen der Bevölkerung gelesen werden. Wir, der Bund für Deutsche Schrift und Sprache e.V. (BfdS) und die Sütterlinstube Hamburg e.V. fühlen uns durch dieses Urteil in unserem jahrzehntelangen ehrenamtlichen Bemühen um die Förderung der deutschen Schriften als einer wichtigen Kulturtechnik und um die Lesbarhaltung von Kulturgütern, die in diesen Schriften über einen Zeitraum von 500 Jahren verfasst wurden, bestätigt. Fast täglich erhalten wir Bitten um Übertragung von Akten, Tagebüchern, Briefen, Berichten und Urkunden aus den deutschen Schriften in die gängigen Antiquaschriften. Das Urteil verpflichtet die öffentliche Verwaltung auch dazu, Eingaben in deutscher Schrift kompetent zu bescheiden. Dazu sind in den Behörden entsprechende Kenntnisse vorzuhalten (siehe auch diesbezügliche Beschlüsse von Petitionsausschüssen des Deutschen Bundestages). Dabei können BfdS und Sütterlinstube, aber auch andere (vorhandene und noch zu gründende) haupt- und ehrenamtliche Initiativen, durchaus unterstützend tätig sein. Wir können aber den Behörden insbesondere keine hoheitlichen Aufgaben abnehmen (wie hier die Kontrollaufgaben einer JVA, aber auch die notarielle Beglaubigung der Übertragung von Urkunden und Grundbuchauszügen mit hohem ideellen, teilweise aber noch aktuellem materiellen Wert). Ehrenamtliches Engagement ist aber auch gefordert, um Hochschulen, Archive, Museen und öffentliche Bibliotheken bei ihrer Arbeit der Erschließung von Texten in deutscher Schrift für heutige Benutzer zu unterstützen. Hier müssen Strategien entwickelt werden, an deren Entwicklung wir gern mit unseren Erfahrungen mitwirken können. Es geht um die Bewahrung von hohen Kulturgütern. 24.6.2009 Seesen Bund für deutsche Schrift und Sprache e.V. Hanno Blohm, 1. Vorsitzender Vorsitzer@BfdS.de Hamburg Sütterlinstube Hamburg e.V. Dr. Peter Hohn, 1. Vorsitzender Dr.Peter.Hohn@suetterlinstube.org |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Halle (Saale) |
Dieser Beitrag wurde am 01.11.2009 um 22.44 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#5522 epd, 1. November 2009 (Bis auf den letzten Absatz auch unter http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/3/0,3672,7920899,00.html zu finden.) Die FAZ feiert ihren 60. Geburtstag im Stillen Eigenwillig war sie schon immer. Als am 1. November 1949 die erste "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) erschien, sollte sie "für die Idee der Sozialen Marktwirtschaft werben" und sich an "nachdenkliche Menschen aus allen Berufen und Altersgruppen" wenden. Ihr 60-jähriges Bestehen feiert die Zeitung nach Angaben ihres Mitherausgebers Berthold Kohler "im Stillen. Uns selbst zu feiern ist noch nie so recht unsere Art gewesen." Von Ellen Reglitz Mutter der FAZ war die Wirtschaftspolitische Gesellschaft (WIPOG), die die Zeitung als Gegengewicht zu den sozialistisch geprägten Gewerkschaften und Behörden im frühen Nachkriegsdeutschland gründete. Mitglieder der WIPOG waren überwiegend Unternehmer, Verbandsfunktionäre und Politiker. Die Auflage lag zunächst bei 60.000, lange war die Zeitung von Zahlungen der Industrie abhängig. Erst ab 1952 ließ sich Geld verdienen. "Sie fordert den Leser heraus" "Dahinter steckt immer ein kluger Kopf", lautet seit 1961 der Werbespruch der FAZ, deren eigener Kopf eben nicht nur durch Klugheit - fast alle Redakteure verfügen über ein Hochschulstudium, viele tragen einen akademischen Titel - sondern auch durch Eigenwillen besticht. Die Zeitung vertritt ihre Meinung, konservativ im Politikteil, progressiver im Feuilleton. "Qualitätsjournalismus mit Objektivitätskriterien zu messen, ist ein falscher Ansatz. Dafür ist die FAZ vielleicht der beste Beweis", schreibt der Wissenschaftler Kai Burkhardt in einem noch unveröffentlichten Manuskript aus einer Studie des Berliner Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik. Wie jede ernstzunehmende Zeitung sei auch die FAZ dazu da, Meinungsbildung zu betreiben. "Sie fordert ihre Leser allerdings stärker intellektuell heraus als andere Medien." Für den Mainzer Medienwissenschaftler Jürgen Wilke ist die FAZ deshalb "eine herausragende, wenn nicht gar die herausragende Zeitung Deutschlands". Die journalistische Qualität des Blattes macht er am Umfang der Berichterstattung und ihrer Vertiefung fest. Ihr Erfolg gibt der Zeitung Recht: Mit einer derzeitigen verkauften Auflage von 367.535 gehört die FAZ heute zu den führenden überregionalen Blättern. Kämpferin gegen neue Rechtschreibung Im Laufe ihrer Geschichte wurde die Zeitung wiederholt Zentrum von Kampagnen, etwa gegen die Rechtschreibreform: Nach der ersten Reform von 1998 kehrte die Zeitung im Jahr 2000 vorübergehend zur alten Schreibweise zurück. Ab Januar 2007 stellte sie dann doch auf weitgehend auf die neue Fassung um. Seitdem druckt die FAZ nach einer eigenen Hausorthografie. Eigenwillig ist auch die Organisation der Zeitung: Von Beginn an verzichtete die FAZ auf einen Chefredakteur, stattdessen bestimmt ein fünfköpfiges Herausgebergremium die Linie des Blattes, das bislang ausschließlich von Männern besetzt war. Jeder der Herausgeber - derzeit Werner D'Inka, Berthold Kohler, Günther Nonnenmacher, Frank Schirrmacher, Holger Steltzner - ist für jeweils einen Teil der Zeitung zuständig. "Gerade in der Krise Qualität sichern" Über die Jahrzehnte hielt die Zeitung an ihren konservativen Zügen fest, widersetzte sich dem Zeitgeist, auch äußerlich. In der bunten Medienwelt bewahrte die FAZ ihr nüchternes Layout - ohne Titelbild, dafür mit Bleiwüste. Bis zum 5. Oktober 2007, als das Blatt erstmals mit Seite-Eins-Foto erschien. Diesen Relaunch bezeichnet Kohler als "größten Evolutionssprung" der FAZ. Das Foto kommt gut an. Gelegentlich sei in Leserzuschriften sogar von "Kult" die Rede, sagt Kohler. Der Wandel habe sich jedoch vor allem äußerlich vollzogen: Das inhaltliche Profil der FAZ sei unverändert geblieben, nämlich "freiheitsliebend". Im Jahr ihres 60-jährigen Bestehens bleibt auch die FAZ nicht von der Wirtschaftskrise verschont: "Die Anzeigenflaute, die als Folge der Wirtschaftskrise allen Verlagen Umsätze raubt, hat aber auch uns Umsatzeinbußen beschert", sagt Kohler. Die Herausgeber schlössen betriebsbedingte Kündigungen in der Redaktion indes aus: "In diesen Zeiten kommt es mehr denn je auf die Sicherung der journalistischen Qualität an." Und drum hat der Herausgeber auch einen schlichten Ratschlag für die Zukunft seiner Zeitung: "Qualität ist unsere Leidenschaft und unsere Zukunft. Diesen Pfad dürfen, wollen und werden wir nicht verlassen." www.evangelisch.de |
| nach oben | |
|
Edelgard Mank Düsseldorf |
Dieser Beitrag wurde am 08.11.2009 um 03.06 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#5575 NDR, WDR und BR machen Bluttests bei Stellenbewerbern So fängt es an. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Genau so. Warum verhalten sich Firmen – in diesem Fall Medien genau so, wie düstere Zukunftsperspektiven das schon voraussagen? Haben Medien denn überhaupt keine kritische Distanz mehr zu ihrem Tun? Oder wenigstens zu dem überall vorausgesagten Überwachungsstaat? Sind die denn noch zu retten? Wissen die denn, was sie tun?! http://www.ksta.de/html/artikel/1256136975727.shtml http://www.sueddeutsche.de/d5k38G/3132718/Zwang-zur-Diagnose.html Diese Nachricht müßte eigentlich on the top stehen; sie ist wichtig für jede/n Schreibende/n. |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Halle (Saale) |
Dieser Beitrag wurde am 17.11.2009 um 08.48 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#5618 Digitalisierung Warum Google auf deutsche Bücher verzichtet Von Hendrik Werner Liest die Welt bald nur noch englisch? Googles Ansinnen, alle Bücher kostenlos ins Internet zu stellen, hat einen empfindlichen Dämpfer bekommen. Denn das darf das Unternehmen jetzt nur noch mit Werken aus den USA, Kanada, Australien und Großbritannien tun. Doch der Jubel der Google-Gegner hält sich in Grenzen. Zuletzt hatte sich der anfangs nur linde Gegenwind zu einem Orkan der Entrüstung ausgewachsen: Die Bundesregierung, die Verwertungsgemeinschaft Wort, der Börsenverein des Deutschen Buchhandels sowie etliche hiesige Verleger und Autoren - sie alle liefen, wenn auch nicht immer gemeinsam, Sturm gegen das "Google Book Settlement". Jenen 2008 in den USA von dem kalifornischen Internetkonzern sowie Autoren- und Verlegerverbänden ausgehandelten Vergleich, der es Google gegen einen bescheidenen Obolus ermöglichen sollte, weltweit urheberrechtlich geschützte Bücher zu digitalisieren, um diese im Internet gratis verfügbar zu stellen. Seit dem Wochenende scheinen die ambitionierten Träume des Suchmaschinisten von der globalen Buchmarktherrschaft - zunächst - zerstoben: Nach Protesten, zumal europäischen, haben der Internetkonzern und die US-Verleger eine deutlich abgemilderte Version der umstrittenen Vereinbarung für die Bereitstellung von gescannten Büchern im weltweiten Netz vorgelegt. Nach wiederholter Vertagung der Anhörung vor einem Gericht in New York verständigten sich beide Seiten jetzt darauf, den Geltungsbereich der Vereinbarung auf Bücher zu beschränken, die urheberrechtlich in den USA, in Kanada, Großbritannien und Australien registriert sind. Mit dieser revidierten Fassung des Vergleichs, die der zuständige Richter am Federal District Court in Manhattan, Denny Chin, nun angenommen hat, wären mehr als 95 Prozent der Bücher, die in Deutschland oder anderen Ländern außerhalb dieses Geltungsbereichs verlegt wurden, nicht länger Bestandteil und Verhandlungsmasse der Einigung. Bis Ende vergangener Woche hatten Google, der Verlegerverband AAP sowie die Autorenvereinigung Authors Guild gestritten und nachgebessert, um jene mehr als 400 Einsprüche gegen das Abkommen zu entkräften, die etwa vom US-Justizministerium und von ausländischen Verlegern formuliert worden waren. Gegen Ende der Beratungen sahen die Verhandlungsparteien ein, dass eine Einigung mittelfristig nur mit Ländern zu erzielen sei, die eine strukturell gemeinsame Rechtsauffassung teilten - oder zumindest vergleichbare Buchhandelspraktiken. Der Vertragsentwurfsvorschlag zur Güte, mit dessen Abschluss mutmaßlich bei einer Anhörung am 18. Februar 2010 zu rechnen ist, würde bedeuten, dass digitalisierte deutschsprachige Titel aus hiesigen Beständen nicht mehr in der Google-Buchsuche angezeigt werden dürfen. Nicht gehindert werden kann der Internetkonzern indes an weiteren Scan-Aktivitäten hierzulande im Rahmen seiner legalisierten Abkommen mit einigen Verlagen und Bibliotheken. Sollten solche Titel allerdings widerrechtlich in der Volltextsuche von books.google.de aufgelistet werden, kann dagegen in Deutschland prozessiert werden. Weitere Konzessionen Weitere Konzessionen musste Google in einem Punkt machen, an dem sich Widerspruch seitens des US-Justizministeriums entzündet hatte. Es geht um den Umgang mit "verwaisten Büchern", mit vergriffenen, aber immer noch urheberrechtlich geschützten Titeln, deren Autoren nicht auffindbar sind. Die Neufassung der Einigung sieht vor, dass die Erlöse aus dem Verkauf der digitalisierten Titel nunmehr zehn Jahre lang eingefroren werden sollen. Innerhalb dieser Zeit ist es Rechteinhabern möglich, Ansprüche geltend zu machen. Für verwaiste Werke soll zudem ein Treuhänder eingesetzt werden, der die Rechte der Autoren vertritt. Bislang hat Google etwa sechs Millionen vergriffene Bücher gescannt - und diese online partiell zugänglich gemacht. Bis dato erlaubt es die "Google Book Search" Nutzern indes nur, weite Passagen dieser Titel im Internet einzusehen. Die gerichtlich genehmigte Einigung mit Verlegern und Autoren würde es Google zudem möglich machen, digitale Kopien der Bücher in Gänze auch zu verkaufen. Aus diesem Grund gehen der "Open Books Alliance", in der sich die Google-Mitbewerber Microsoft, Yahoo und Amazon zusammengeschlossen haben, die jüngsten Zugeständnisse des Rivalen nicht weit genug. Als einen bloßen "Taschenspielertrick", mit dem Google seine kommerziellen Interessen durchsetzen wolle, bezeichnete ein Sprecher der Zweckallianz die Konzessionen. Ungezaust geht Google bei dem revidierten Entwurf nur in einem einzigen Pünktchen hervor: Rechteinhaber in den von der Einigung betroffenen angloamerikanischen Ländern sollen, wie ursprünglich vorgesehen, 63 Prozent der Einnahmen aus der Buchsuche erhalten, Google dagegen 37 Prozent. Deutsche Autoren und Verlage dagegen würden zwar all ihre rechtlichen Ansprüche gegen Google behalten, verlören allerdings ihre Aussicht auf jene wenig generösen 60 Dollar, die Google als Entschädigung pro ungenehmigt genutztem Buch aus der Einigungs-Kriegskasse verheißen hatte. Diese finanziellen Einbußen scheinen indes verzichtbar angesichts eines kulturellen Kuhhandels, der das literarische Gedächtnis der Menschheit und individuelle Anstrengungen hiesiger Autoren mit einer Handvoll Dollar aufwiegen wollte. Skeptisch auf den neuen Einigungsvorstoß reagierte Gottfried Honnefelder, Vorsteher des Börsenvereins. Es bestehe die Gefahr, dass Europa, abgesehen von Großbritannien, nunmehr von der Buchdigitalisierung abgeschnitten und kulturell weniger bedeutsam werde. Dies darum, weil die revidierte Einigungs-Fassung "das Englische weiterhin als Marktsprache schlechthin" etablierte. Honnefelder und andere Buchmarktfunktionäre plädieren aus diesem Grund seit langem für eine Stärkung genuin europäischer Digitalisierungs- und Online-Buchmarkt-Projekte. Obwohl der literarische Krake Google in seine Schranken gewiesen worden ist, hält er an seinem Streben nach globaler Buchmarktherrschaft fest: Sein Konzern wolle nach wie vor mit Rechteinhabern weltweit kooperieren, um die Vision vom Zugriff auf das Menschheitswissen zu realisieren, sagte Google-Manager Dan Clancy. Dass er zeitnahe Gespräche gerade mit europäischen Urhebern ankündigte, lässt eine unendliche Geschichte auch im Falle einer gerichtlichen Einigung im Februar erahnen. (www.welt.de, 16. November 2009) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Halle (Saale) |
Dieser Beitrag wurde am 17.11.2009 um 08.54 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#5619 S.Z., 16. November 2009 Googles Buch-Digitalisierung Geschrumpfte Weltbibliothek Kompromissvorschlag aus Kalifornien: Google spart bei der Digitalisierung von Büchern vorerst wichtige Regionen aus - unter anderem Deutschland. Google hat seine Pläne, eine Art digitaler Weltbibliothek im Internet aufzubauen, vorläufig stark eingeschränkt. Nach dem überarbeiteten Entwurf des "Google Settlement" zur Bereitstellung digitalisierter Bücher, den Google zusammen mit den Verbänden der amerikanischen Autoren und Verleger am Freitag in New York vorstellte, sollen nun nur noch Bücher online verfügbar gemacht werden, die in den USA, Kanada, Großbritannien und Australien erschienen sind. Nach dem neuen Entwurf soll zudem ein unabhängiger Treuhänder eingesetzt werden, der über den Umgang mit vergriffenen Büchern - deren Rechteinhaber unbekannt oder nicht kontaktierbar sind - wacht und Lizenzen zu ihrer Verwertung im Internet auch an Google-Konkurrenten wie Amazon oder Microsoft erteilen kann. Das Geld, das damit verdient wird, soll für zehn Jahre eingefroren werden. Wenn die Rechteinhaber während dieser Zeit ihre Ansprüche nicht geltend machen, soll es Wohlfahrtszwecken zukommen. Damit sind die umstrittensten Aspekte von Google Books erheblich entschärft. Google hätte das ursprüngliche Modell am 7. Oktober dem zuständigen New Yorker Richter Denny Chin vorlegen sollen. Doch schon seit Anfang des Jahres wurde die Kritik daran weltweit immer lauter. Nach Autoren und den Vertretern der Buchbranche, vor allem aus Deutschland und Frankreich, kritisierten auch europäische Politiker das Vorgehen von Google. Konkurrenten nicht zufrieden Als schließlich das US-Justizministerium den Richter im September bat, den Entwurf wegen des problematischen Umgangs mit dem Urheberrecht abzulehnen, blieb Google und seinen Partnern aus der amerikanischen Buchbranche nichts anderes übrig, als die Modalitäten in Rekordzeit zu überarbeiten. Richter Chin wird über den neuen Entwurf nun Anfang nächsten Jahres entscheiden. Mit der neuen Fassung bemühen sich Google und die Verleger auch, von der US-Regierung geäußerte Sorgen aus der Welt zu räumen, Google schaffe sich eine Monopolstellung im digitalen Buchmarkt. Konkurrenten wie Microsoft, Yahoo und Amazon haben es nun leichter, eigene Online-Bibliotheken aufzubauen. In ersten Reaktionen zeigten sich diese allerdings nicht zufrieden. Peter Brantley, der Vorsitzende der Open Book Alliance, einem Verband von Google-Konkurrenten, Universitäten, Bibliotheken und Museen, bezeichnete die Modifikationen als "Täuschungsmanöver": "Das Settlement dient nach wie vor ausschließlich den privaten kommerziellen Interessen von Google und seinen Partnern." Der Google-Sprecher Dan Clancy sagte, er sei enttäuscht, dass die Buchsuche sich nun beim urheberrechtlich geschütztem Material auf englischsprachige Texte beschränke. Doch man gebe nicht auf: Gespräche mit Verlagen und Autoren in Europa sollen in Kürze beginnen. (www.sueddeutsche.de) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Halle (Saale) |
Dieser Beitrag wurde am 17.11.2009 um 08.59 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#5620 S.Z., 17. November 2009 David gegen Googliath Buch-Digitalisierung Google schränkt sich beim Einscannen von Büchern aus Europa ein. Das birgt für deutsche Verlage die Gefahr, die Digitalisierung weiter zu verschlafen. Ein Aufatmen geht durch die Reihen deutscher Verlage und Buchhändler. Die neu verabschiedete, überarbeitete Version des umstrittenen Google Book Settlement betrifft eine wesentlich geringere Anzahl deutscher Bücher als noch in der ersten, harsch kritisierten Version des Vertrages vorgesehen. Laut Paul Aiken, dem Chef der amerikanischen Autorengewerkschaft, fallen "mehr als 95 Prozent" aller nicht englischsprachigen Bücher aus der neuen Vereinbarung. Nach wie vor in Googles Visier sind aber deutsche oder in Deutschland erschienene Bücher, die in den USA ins Copyright-Register für ausländische Bücher eingetragen wurden. Das betrifft vor allem Bücher, die vor 1978 erschienen sind. Davor waren die unterschiedlichen Urheberrechtsgesetze und die fehlende völkerrechtliche Verbindung der Gesetze Grund genug für viele Verlage und Autoren, ihre Bücher mit ebendiesem Copyright-Eintrag in den USA schützen zu lassen. Wie viele Verlage und Autoren damals dem Hinweis gefolgt sind, wie viele deutsche Bücher also immer noch von Googles Digitalisierungsstrategie betroffen sind, ist unklar. Amerikanische Liste wird veröffentlicht Auf der anderen Seite ist die amerikanische Liste noch nicht veröffentlicht worden. Das soll nun schnellstmöglich nachgeholt werden. Erst dann will auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels prüfen, ob er erneut gegen Google vorgehen wird. Das Google Book Settlement ist ein vor einem New Yorker Gericht ausgehandelter Vertrag, in dem festgelegt wird, welche Bücher Google für seinen Online-Service Google Books nutzen darf. Nachdem im Verlauf des Jahres Autoren, Verlage und europäische Politiker das Unternehmen immer schärfer kritisiert hatten und das US-Justizministerium den Richter bat, den Entwurf wegen des problematischen Umgangs mit dem Urheberrecht abzulehnen, hat Google am Freitag seinen neuen Entwurf vorgelegt. Nach der neuen Fassung sind von dem Buchvergleich bis auf die erwähnten deutschen und weitere europäische Ausnahmen nur noch Werke betroffen, die entweder bei der amerikanischen Urheberrechtsbehörde registriert oder die in anderen englischsprachigen Ländern erschienen sind. Die technischen Möglichkeiten erlauben es, von Google digitalisierte Bücher nicht nur im Volltext zu durchsuchen, sondern auch vollständig online zu lesen. Allerdings ermöglicht Google diese Optionen nicht bei allen digitalisierten Büchern. Google Books soll sich in Zukunft durch Werbeeinblendungen finanzieren. Wann darf Google scannen? Außerdem sollen ab 2010 kostenpflichtige, digitale Zugänge zu von Verlagen freigegebenen Büchern eingeführt werden. Die Einnahmen daraus wird sich Google dann mit den Verlagen teilen. Bislang wird der Service allerdings nach Angaben von Google firmenintern mit einem hohen dreistelligen Millionenbetrag im Jahr subventioniert. Unter welchen Umständen Bücher von Google digitalisiert werden dürfen, ist umstritten. Zur Kritik trug auch bei, dass Google bereits viele Bücher ohne Anfrage bei den Rechteinhabern eingescannt hat. Unproblematisch ist dies nur, wenn die Bücher gemeinfrei sind - also älter als 70 Jahre. Im Fall von verfügbaren Büchern und bei Werken, deren Urheber nicht auffindbar sind, war Googles Verhalten auf Dauer nicht durchsetzbar. Der Erfolg für die deutschen Verlage und andere Rechteinhaber birgt auch die Gefahr dauerhafter Rückständigkeit. Denn Google ist - so sehr dies hinsichtlich der Monopolgefahr bedenklich stimmen mag - eine der treibenden Kräfte, die die Welt ins digitale Zeitalter bewegen. Kulturgüter, die bei diesem Prozess nicht mitgenommen werden, laufen Gefahr, in Vergessenheit zu geraten. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels fordert bekanntlich die "Schaffung einer Deutschen Digitalen Bibliothek." Das klingt sinnvoll. Wer aber die bestehenden Projekte aus deutscher Hand im Netz kennt, zweifelt am Erfolg eines solchen Modells. Einerseits, weil die Konkurrenz übermächtig ist: Google ist mit schier unendlichen Bargeldreserven ausgestattet. Andererseits aber auch deshalb, weil deutsche Verlage und öffentliche Einrichtungen nach wie vor das Netz als Ort für den erweiterten Abverkauf begreifen - aber nicht als Chance für mediengerechte Innovationen. Sinnfreie Volltext-Suche Deutlich wird dies am Projekt Libreka des Börsenvereins, das oft zum Google-Books-Konkurrenten ernannt wurde. Die Webseite ist aber nichts als eine schlichte Plattform für den Buchverkauf, auf der man in ein paar digitalisierten Buchseiten blättern kann. Die gepriesene Volltext-Suche, mit der man gelistete Bücher durchsuchen kann, funktioniert zwar, bleibt aber aufgrund der begrenzten Funktion des Angebotes sinnfrei. Was hat der Suchende davon, zu wissen, dass Mephisto zwar in Goethes "Faust" zu finden ist, solange er den eigentlichen Treffer seiner Suche nicht sehen kann, weil Libreka von "Faust" nur das Vorspiel auf dem Theater bereit hält. So klaffen noch weite Qualitätsgräben zwischen Google und den selbsternannten Konkurrenten. Google plant, ein digitales Netz aus sämtlichen Büchern zu schaffen. Der kulturelle wie wirtschaftliche Preis dafür ist hoch; er umfasst Urheberrechte, Nutzungsbedingungen und Stilfragen. Die Verlage aber klammern sich an eine Zeit, in der das Internet nicht mehr war als eine Idee im Kopf seiner Erschaffer. (www.sueddeutsche.de) |
| nach oben | |
|
Arno Pielenz Cottbus |
Dieser Beitrag wurde am 17.11.2009 um 11.02 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#5622 Die scheinheilig unter "open access" und "freier Zugang zu Wissenschaft und Kultur" praktizierte Digitalisierung aller gedruckten Bücher ist nichts anderes als gesetzlich erlaubte Produktpiraterie, mit der die Autoren ihres geistigen Eigentums beraubt werden. Diese Internet-Texte sind nicht anders zu bewerten als "echte" Levi's, made in China. |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Halle (Saale) |
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2010 um 23.37 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#6169 Deutsche Welle, 1. Februar 2010 Grammatik zum Ortstarif Die oder der Butter? Die Tücken der deutschen Sprache lauern schon auf dem Frühstückstisch. Doch es gibt kompetente Abhilfe: Die TU Chemnitz bietet einen kostengünstigen Service im Sprachdschungel der Muttersprache. Donnerstagnachmittag, kurz nach 14 Uhr. In einem Nebengebäude der Technischen Universität Chemnitz sitzt Ruth Geier am Telefon und spricht mit einem Rentner, der wissen will, ob er seinen Nachnamen künftig mit ß schreiben müsse. Wegen der Rechtschreibreform sei er unsicher geworden, sagt er. Germanistin Geier kann den älteren Herrn beruhigen - Kessler bleibe Kessler. Daran ändere auch die Rechtschreibreform nichts. Orthografie, Grammatik, Eigennamen - mit Sprache kennt sich Ruth Geier aus. Besonders mit der deutschen. Seit dem Jahr 2000 bietet die Germanistin ihre Sprachberatung an der TU Chemnitz zum Ortstarif an - jeden Donnerstag, von 14 bis 16.30 Uhr. "Bei mir melden sich hauptsächlich Menschen, die auch beruflich mit der deutschen Sprache zu tun haben", sagt Geier, "also Sekretärinnen, Journalisten, Werbetexter." Aber auch Bestattungsunternehmen rufen bei Geier an, um sicherzugehen, dass der letzte Gruß auf der Schleife orthografisch korrekt ausfällt. Ewige Stolpersteine Es gibt einige Fragen, die muss Geier immer wieder beantworten. Zum Beispiel, ob es im Herbst dieses oder diesen Jahres heißt. Richtig ist im Herbst dieses Jahres. Unsicher sind viele auch bei der Datumsangabe: am Freitag, dem oder den 3. März. Laut Duden sind beide Varianten möglich. Aber auch die Kommasetzung sei ein Dauerthema, daran habe die jüngste Rechtschreibreform nichts geändert, erzählt die Germanistin. [Bild: Frau Geier am Telefon, davor drei Dudenbände: zur Rechtschreibung, das Herkunftswörterbuch und ein nur unvollständig erkennbarer] Auch wenn die Nachfrage nach korrektem Deutsch noch immer hoch ist, das Telefon klingelt nicht mehr ganz so häufig. Die meisten Anfragen gehen heute per Email ein. Ein Team aus Studenten des Fachbereichs Medienkommunikation kümmert sich um die Anfragen, die von überall her in Chemnitz eintreffen. Rebecca Juwig, die seit dem ersten Semester bei der Sprachberatung dabei ist, wollte eigentlich nur ein ganz normales Seminar besuchen. "Im Bachelor gab es noch den Anreiz, dass man hier einen Schein für relativ wenig Aufwand bekam", erinnert sich die 27-Jährige. Die Aussicht war verlockend. Mittlerweile gibt es keine Scheine mehr, aber die Studentin ist immer noch im Team - nun im Masterstudiengang. "Für mich besteht die Herausforderung heute darin, mehr über meine eigene Sprache zu lernen", so Juwig. Wissen, wo's steht Haupthilfsmittel der Chemnitzer Sprachfüchse sind klassische Nachschlagewerke, also Wörterbücher, Lexika - aber auch Online-Verzeichnisse. Das Grimm'sche Wörterbuch gibt ebenso wertvolle Hinweise, etwa zur Etymologie von Begriffen, wie auch Wikipedia. "Dort finden sich viele Informationen aber nicht in den Texten, sondern vielmehr in den weiterführenden Links unter den Beiträgen - das sind oft nützliche Quellen", verrät Rebecca Juwig. Zum harten Kern der studentischen Sprachberater gehört auch David Füleki. Der 25-jährige Comiczeichner hat das Maskottchen der Sprachberatung entworfen, den Robobob, der die Besucher auf der Homepage begrüßt. Im Alltag durchzuckt es Füleki häufig, wenn er bei "Gabi's Mode-Eck" mal wieder über den Apostroph beim Genitiv stolpert. "Das ärgert einen natürlich", sagt Füleki. "Aber was will man machen - am Ende glaubt es die Gabi sowieso nicht, wenn man sie darauf aufmerksam macht." Trotzdem würde es den Studenten freuen, wenn Gabi vorher bei der Chemnitzer Sprachberatung angerufen und sich informiert hätte. Aber auch so wird die deutsche Sprache ein heikler Fall bleiben. Unheimlich schön, aber anspruchsvoll - so dass die Arbeit in Chemnitz kaum ausgehen dürfte. Und, wer weiß, vielleicht ruft ja eines Tages Gabi doch noch an. (www.dw-world.de) |
| nach oben | |
|
Sigmar Salzburg Mohrkirch |
Dieser Beitrag wurde am 06.05.2010 um 22.00 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#6369 Ein neuer Spaß: Das Google-Wunderrad ... Ein erstes Experiment unter "rechtschreibung.com" |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Halle (Saale) |
Dieser Beitrag wurde am 04.06.2010 um 17.28 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#6475 Neue OZ / Wittlager Kreisblatt, 2. Juni 2010 Sie können noch Platt proten 15 Autoren, 15 Geschichten, und am Ende geht es vor allem darum: dass eine Sprache lebendig bleibt. Seit mittlerweile 20 Jahren gibt es den Plattdeutschen Förderkreis in der Region Osnabrück und mit ihm die Schreibwerkstatt für plattdeutsche Autoren. Am Wochenende trafen sich die „Plattfoss“ zur intensiven Textarbeit in der Wallenhorster Hofstelle Duling. „Wir haben heute sehr produktiv gearbeitet“, sagt Elisabeth Benne. Sie leitet die Schreibwerkstatt, die zweimal jährlich stattfindet. Hier versammeln sich plattdeutsche Autoren aus der gesamten Region Osnabrück, „von Alfhausen bis Bad Essen, von Versmold bis Lohne“, wie der Förderkreis schreibt. „Wir fühlen uns dem Platt der Region Osnabrück absolut zugehörig“, sagt Helga Uhlmann, die aus dem westfälischen Versmold kommt. Die regionalen Unterschiede sind trotzdem nicht zu überhören: In Versmold „küöt“ man Platt, während man in Elisabeth Bennes Heimat Bad Rothenfelde (und auch in Wallenhorst) „küert“. „Es bleibt trotzdem dieselbe Sprache“, sagt Elly Wübbeler aus Bad Essen. „Wir verfolgen außerdem für alle Akzente dasselbe Ziel: Das Schriftbild des Plattdeutschen lesbar zu machen und das heißt, es dem Hochdeutschen so weit wie möglich anzunähern.“ Konkret heißt das etwa, dass die Vorsilbe „weg-“ auch im Plattdeutschen mit g geschrieben wird, obwohl ein nicht Anwesender im gesprochenen Platt eindeutig „wech“ ist. Eine verbindliche Rechtschreibung gibt es für das Plattdeutsche nicht – nur das „Kleine plattdeutsche Wörterbuch“ des Hamburgers Dr. Johannes Saß aus dem Jahr 1972. Wie jede Sprache sei aber auch das Plattdeutsche ständig im Fluss und müsse sich deshalb anpassen, sagt Elly Wübbeler. Die Texte und das Schriftbild der Autoren würden deshalb ganz offen und ehrlich diskutiert und kritisiert – „aber immer positiv“, wie Elisabeth Benne sagt. [...] (www.neue-oz.de) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Kiel |
Dieser Beitrag wurde am 19.08.2010 um 13.27 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#6753 Düstere Perspektiven für die Medien-Schweiz Bestandsaufnahme einer Forschergruppe um Professor Kurt Imhof Von Rainer Stadler Eine Forschergruppe um Kurt Imhof zieht eine sehr kritische Bilanz zur Schweizer Medienlandschaft. Sie sieht die nachhaltige Information über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gefährdet. Dies wiederum habe negative Auswirkungen auf das demokratische Gemeinwesen. Weit verbreitet ist die Befürchtung, es gehe puncto Qualität der journalistischen Angebote vor allem bergab. Diese Ansicht teilt auch der Zürcher Soziologieprofessor Kurt Imhof. Am Freitag hat er ein umfassendes Datenmaterial der Öffentlichkeit vorgestellt, das einen Überblick über die Schweizer Medienlandschaft verschafft und die düsteren Perspektiven wissenschaftlich bekräftigt. Im Kern geht es den Forschern um eine politische, inhaltliche Frage: Unterrichten die Schweizer Medien die Bevölkerung so, dass die Bürger wohlinformiert an den demokratischen Prozessen teilnehmen können? Die Autoren erkennen höchst problematische Tendenzen: * In allen Mediengattungen wächst das Angebot an Klatsch bzw. an sogenannten Softnews, welche die klassischen publizistischen Kernthemen Politik, Wirtschaft und Kultur zurückdrängen. * Die Nachhaltigkeit der Berichterstattung lässt nach. Episodische, auf Personen, Konflikte und Katastrophen zugespitzte Informationen nehmen zu. * Obwohl die Welt zusammenwächst, schotten sich die Medien ab, indem sie die Auslandberichterstattung stark abbauten. «Die grossartige Tradition der schweizerischen Auslandberichterstattung bricht ein», notiert das Jahrbuch. * Die Wirtschaftsinformation bleibt mangelhaft. * Der Erfolg der Gratiszeitungen und die Gratisangebote im Internet senkten unter den Konsumenten das Bewusstsein dafür, dass Informationsqualität etwas kostet. * Der Einbruch bei den Werbeeinnahmen erschwert die Finanzierung der redaktionellen Leistungen. * Die Bedeutung derjenigen Medientitel, die wenig zur Informationsqualität beitragen, wird weiter wachsen. * Der recherchierende, einordnende Journalismus gerät weiter unter Druck. * Auch die Presse orientiert sich vermehrt an den Unterhaltungsbedürfnissen der Medienkonsumenten «statt an Informationsbedürfnissen der Staatsbürger». Diese Trends gefährden nach Ansicht von Imhof das Funktionieren der Demokratie in der Schweiz. Mit seinen Forschungsdaten will er nun die Diskussion über Aufgabe und Qualität der Medien fördern. Der von ihm geleitete Forschungsbereich Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich hat die Ergebnisse in einem 370-seitigen Jahrbuch zusammengefasst, das Informationen enthält zu Besitzverhältnissen, Bilanzen, Publikumsverhalten und politischen Rahmenbedingungen sowie Analysen der Themen- und Informationsakzente, welche die verschiedenen Medientitel setzen. Die Daten werden künftig laufend im Internet aktualisiert (www.qualitaet-der-medien.ch). Gedruckte Jahresbilanzen sollen auch in den kommenden Jahren erscheinen. Für sein Projekt einer kontinuierlichen Medienbeobachtung hat Imhof namhafte Gönner gewinnen können, unter ihnen die Allreal Holding, den Anne Frank Fonds, die Credit Suisse Foundation, die Paul Schiller Stiftung, die Otto Beisheim Stiftung, die Schweizerische Mobiliar, die Schweizerische Post, Swiss Re, die Vontobel-Stiftung, die Zürcher Kantonalbank, die Stiftung für Gesellschaft, Kultur und Presse sowie die Stiftung Qualitätsjournalismus Ostschweiz. Den ausführlichen Text sowie einen Kommentar lesen Sie in der «Neuen Zürcher Zeitung» vom 14. August. (NZZ online, 13. August 2010) (Interessante Anmerkungen dazu von Oliver Bendel unter http://crazyprocesses.blog.de/2010/08/13/duestere-perspektiven-schweizer-medien-9175073/.) |
| nach oben | |
|
Reinhard Markner Berlin |
Dieser Beitrag wurde am 26.09.2010 um 23.23 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#6904 Lesenswert: Gunnar Schupelius in der B. Z. über das von Rechtschreibreform-Veteran Jürgen Zöllner angeordnete »Jahrgangsübergreifende Lernen«, ein Verdummungsprogramm für Zweitkläßler. |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Kiel |
Dieser Beitrag wurde am 05.11.2010 um 19.29 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#7092 Gottes eifersüchtiger Rivale Er war der Grandseigneur der holländischen Literatur: Der Schriftsteller Harry Mulisch (83) ist in Amsterdam gestorben. [...] Mulisch erfüllte nicht nur als Erzähler seine Pflicht, sondern auch als politischer Intellektueller comme il faut. Als guter Linker engagierte er sich für die 68er und die Amsterdamer Provos, die Antiatom- und Friedensbewegung, gegen die Rechtschreibreform und für die Aussöhnung zwischen Deutschland und Holland. [...] (Badische Zeitung, 2. November 2010) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Kiel |
Dieser Beitrag wurde am 13.12.2010 um 09.41 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#7227 NZZ, 13. Dezember 2010 «Das schnelle, dialogische Schreiben ist eine ganz neue Erscheinung» Die Germanistikprofessorin Christa Dürscheid zum Einfluss der elektronischen Kommunikationsmittel auf die Sprache der Jugend Christa Dürscheid von der Universität Zürich erforscht seit Jahren die Alltags-, speziell die Jugendsprache. Ihre jüngste Studie gilt dem Spagat zwischen dem privaten elektronischen Schreiben und dem Schulalltag. Interview: urs. Frau Professor Dürscheid, Sie kommen in Ihrer jüngsten Studie zum Schluss, der Einfluss elektronischer Kommunikationsformen auf die Sprache in Schulaufsätzen sei weniger stark als gemeinhin angenommen. Auf welche Merkmale haben Sie sich dabei gestützt? Tauchen in Schularbeiten Kürzestsätze auf, muss das noch nicht heissen, dass dies eine Folge des Internet- oder SMS-Schreibens ist. Aber es gibt Schreibweisen, bei denen man ziemlich sicher sein kann, dass sie nur in den neuen Medien vorkommen. Und diese finden sich in den Deutschaufsätzen praktisch nicht. Etwa Konstruktionen wie «*stöhn*»? Zum Beispiel. Natürlich gab es diese Formen früher schon in Comics, aber neu werden sie in privaten Texten ständig ad hoc produziert. Sollte so etwas in Aufsätzen wiederholt vorkommen, ohne als Stilmittel gekennzeichnet zu sein, wäre das ein Anzeichen für einen steigenden Einfluss der neuen Medien. Das war aber in unserer Untersuchung kaum der Fall. Interferenzen gab es eher bei dialektalen Elementen. Sie können als Indiz genommen werden, da Jugendliche ihre Freizeittexte zu gut 90 Prozent in Dialekt verfassen. Das tun sie vor allem, weil man sich in SMS-Situationen und Chats wie in einem Gespräch fühlt. Würden «Die neuen Leiden des jungen W.», jener in Jugendsprache verfasste Roman, heute SMS-typisch transformiert: Was käme vor, ausser «*stöhn*»? Abkürzungen und Sonderzeichen, Kleinschreibung von Nomen und weitere Abweichungen von der Rechtschreibung. Konsequent liesse sich eine solche Umwandlung aber kaum durchführen, da die SMS-Kommunikation stark dialogischen Charakter hat. So wird vieles implizit geschrieben und mit elliptischen Sätzen gearbeitet. Das schnelle, dialogische Schreiben ist eine ganz neue Erscheinung, die es weiter zu untersuchen gilt. Das Verfassen von privaten Briefen und Postkarten ist damit nicht vergleichbar, da hier der Austausch der Nachrichten immer noch mehrere Tage in Anspruch nimmt. Wie stehen Sie zur Behauptung, Jugendliche läsen heute freiwillig keine komplexen Texte mehr? Vieles geschieht heute ja über das gedruckte Wort, oder sagen wir: über das gepixelte. Diese Texte sind meist entsprechend für den Bildschirm optimiert, mit kürzeren Absätzen und Sätzen, mit eingefügten Links und so weiter. Jugendliche lesen also zwar sehr viel, aber selten lange, zusammenhängende Texte, dafür in eine Art Cluster aufgeteilte. Davon lassen sich ja auch schon Printmedien beeinflussen, indem sie etwa mehr Grafiken in Artikel einbauen. Wird der Druck von elektronischen Medien irgendwann so stark, dass sich die Grossschreibung von selbst abschafft? Ich glaube nicht, dass das kommt. Man hätte bei der letzten Rechtschreibereform die konsequente Kleinschreibung einführen können, nahm das aber nicht auf die Agenda, da die Widerstände zu gross waren. Die meisten akzeptieren Kleinschreibung im SMS- oder E-Mail-Verkehr, nicht aber in Zeitungstexten oder Geschäftsbriefen. Täuscht der Eindruck, oder geht bei nachkommenden Generationen das Gefühl für vollständige Sätze verloren? Anhand einiger Seminararbeiten ist mir eine solche Tendenz auch schon aufgefallen. Da stehen zum Teil nur Satzfragmente, und zwar nicht im Sinne eines Stilmittels. Aber vollständige Sätze zu produzieren, ist kein Wert an sich. In der gesprochenen Sprache tun wir das oft auch nicht, und in einer dialogischen Situation ist das gar kein Problem. Ist es also unproblematisch, wenn nachfolgende Generationen viele Sprachnormen ignorieren, ja nicht einmal mehr kennen? Diese geben ja auch einen Rahmen, eine Verbindlichkeit im Austausch. Das ist richtig. Aber man kann diese Normen nicht absolut setzen, sie gelten auch relativ zum Kontext, in dem man spricht oder schreibt. Das bringt uns zur Kernfrage: Ist ein Grossteil der Jugend heute genug befähigt, den Stil, das Register der jeweiligen Situation und Textsorte anzupassen? Bei den Jugendlichen, die in ihrem Schreibstil variieren können und sich der Schreibsituation anpassen, gibt es keinen Grund zur Sorge. Heute wird in der Freizeit viel mehr schriftlich verkehrt als früher. Dadurch sind die Schüler mit dem Schreiben eigentlich besser vertraut. Allerdings: Schrieb man früher betont gepflegt, formuliert die heutige Jugend in der Freizeit oft sehr informell. Die Gefahr ist also grösser, dass man aus diesen privaten Formen nicht mehr auf andere wechseln, nicht genug differenzieren kann. Das Bewusstsein für diese Register ist in der Schule zu fördern, und das wird durchaus auch getan. Die Klagen, die Sprache der Jugend verrohe und verarme, sind nicht neu. Weshalb sind sie so ein Dauerbrenner? Viele Erwachsene haben bestimmte Konventionen verinnerlicht und messen nachfolgende Generationen an diesen Massstäben. Das zieht sich durch alle Zeiten hindurch. In den Medien allerdings ist der Kulturpessimismus zum Sprachgebrauch zurzeit überhaupt nicht stark spürbar. Da hat sich in den letzten zehn Jahren einiges getan. Heute wird der Sprache der Jungen oft Innovativität attestiert. Es gibt gar Tendenzen zur Überhöhung der Jugendsprache. Was gab den Ausschlag für den Wandel in der Wahrnehmung? Das hat sicher mit einer zunehmenden Zahl empirischer Forschungen zu tun, die auch in Medien Verbreitung finden. Wie schätzen Sie als Deutsche das Sprachbewusstsein hierzulande ein? Das Interesse an Themen rund um Sprache und das Bewusstsein dafür sind in der Schweiz sowohl in den Medien als auch in der Bevölkerung sehr ausgeprägt, stärker als in Deutschland. Das ist womöglich schon im Jugendalter so, gerade wegen der Viersprachigkeit und der unterschiedlichen Dialekte, die im Gespräch immer wieder ein Thema sind. Das verbreitete Interesse an Sprache spiegelt sich auch in der starken Resonanz unserer Forschungsgegenstände in den Medien. Für mich als Sprachwissenschafterin ist die Schweiz ein Eldorado. Sollte die Klage über die Sprache der Jugend eher durch Klagen über jene der Erwachsenen abgelöst werden? Ich finde jedenfalls, man sollte bei uns allen das Bewusstsein für das Umgehen mit dem gesprochenen und geschriebenen Wort stärken. In diese Situation kommt man jenseits des Schulalters eher selten – dabei ist es sehr lohnend, wenn man seinen eigenen Sprachgebrauch immer wieder hinterfragt. (www.nzz.ch) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Kiel |
Dieser Beitrag wurde am 08.04.2011 um 22.34 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#7680 Mitteldeutsche Zeitung online, 7. April 2011 Köthen Gute-Nacht-Lektüre und ein Buchstabensüppchen Wer viel schreibt, kommt nicht umhin, ab und zu den Duden zur Hand zu nehmen. Denn Orthografie und Grammatik der deutschen Sprache haben es manchmal in sich. Und die Rechtschreibreform mit ihren zahlreichen Neuerungen hat die Sache nicht einfacher gemacht. Der Duden sollte also beim Schreiben immer in Reichweite liegen. Wer weiß aber schon genau, wer Konrad Duden war, dessen Namen das Nachschlagewerk trägt? Und wer weiß, wo Duden einst gemeinsam mit weiteren Lehrern die ersten Rechtschreibregeln erarbeitete? Schließlich unterrichtete jeder Lehrer früher nach seinen eigenen Rechtschreibregeln. Eine Antwort darauf kann erfahren, wer sich auf eine Reise auf der "Straße der deutschen Sprache" begibt. Vor wenigen Tagen wurde in Köthen der Startschuss dafür gegeben, eine solche Straße zu etablieren. Konrad Duden dürfte dabei auf jeden Fall eine Rolle spielen. So wie es mit der "Straße der Romanik", der "Deutschen Weinstraße" oder der "Deutschen Märchenstraße bereits der Fall ist, soll auch die "Straße der deutschen Sprache" künftig Bildung und Tourismus miteinander verknüpfen. Das ist das erklärte Ziel der Vertreter aus Bad Lauchstädt, Reppichau, Haldensleben, Kamenz, Weißenfels, Schleiz, Gräfenhainichen und Köthen, die sich im Köthener Ratssaal auf die ersten Schritte verständigten. Oberbürgermeister Kurt-Jürgen Zander ließ es sich nicht nehmen, die Gäste persönlich zu begrüßen. "Dieses Vorhaben hat ein überregionales Interesse gefunden. Das freut mich sehr", sagte Zander. Zwar hätten alle Kommunen recht knappe Kassen, so dass die Städte und Gemeinden das Projekt nur in bescheidenem Maße unterstützen könnten. Zander ist jedoch optimistisch, dass das Vorhaben gelingen wird. Unter dem Dach der Neuen Fruchtbringenden Gesellschaft zu Köthen, von dessen Mitglied Thomas Paulwitz die Initiative für die "Straße der deutschen Sprache" ausging, wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die alle grundsätzlichen Fragen regeln soll. Insgesamt 25 Städte aus Mitteldeutschland, in denen sprachgeschichtlich bedeutsame Ereignisse geschehen sind oder wo bekannte Persönlichkeiten der deutschen Sprache lebten, wurden für die Mitarbeit angeschrieben. Bestenfalls könnte die "Straße der deutschen Sprache" also einmal 25 Etappenorte haben. "Schon in knapp einem Monat", so Uta Seewald-Heeg, Vorsitzende der Neuen Fruchtbringenden Gesellschaft, "soll Klarheit darüber herrschen, wer mit von der Partie ist." Dann tagt die Arbeitsgruppe das erste Mal und will "feste Kriterien für die Etablierung der Straße erarbeiten". Wie häufig künftig auf der "Straße der deutschen Sprache" gereist wird, hängt auch von der Werbung für das Projekt ab. Es soll ein einheitliches Logo bekommen und auch einen Internet-Auftritt. Erarbeitet wird außerdem ein Faltblatt, das auf die Besonderheiten der einzelnen Stationen und diverse Ausflugstipps hinweist. Zum 5. "Köthener Sprachtag", zu dem im Juni Besucher aus ganz Deutschland erwartet werden, sollen erste Ergebnisse präsentiert werden. Das Buch von Konrad Duden "Zur deutschen Rechtschreibung" mit Regelwerk und Wörterverzeichnis erschien übrigens im Jahr 1872 in Schleiz. Die Stadt verweist gern auf ihren großen Sohn, machte Otto Pätzold in einem MZ-Gespräch deutlich. Pätzold gehört dem Schleizer Stadtrat an und ist Eigentümer des Hotels "Luginsland". Als Geschäftsmann hat er die Idee mit der "Straße der deutschen Sprache" sofort aufgegriffen und sie in Köthen vorgestellt. Mit einem Drei-Tagesarrangement lädt er dazu ein, die Stadt Schleiz als Wiege der deutschen Rechtschreibung zu besuchen. Seinen Hotelgästen bietet er unter anderem Geschichten um den Schleizer Duden als Gute-Nacht-Lektüre an. Mit Buchstabensüppchen, Dudens Leibspeise, und einem Eis-Dessert mit Russisch Brot greift er das Thema auch kulinarisch auf. Auch einen Besuch im Museum Rutheneum empfiehlt er. Hier kann man sich über Dudens Leben und Werk informieren. "Wichtig ist, dass das Projekt auch von den touristischen Akteuren wie Zimmeranbietern, Museen und Galerien ideenreich mit Leben erfüllt wird. Dann profitieren alle davon", äußerte Pätzold. (www.mz-web.de) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Kiel |
Dieser Beitrag wurde am 09.06.2011 um 20.40 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#7842 Süddeutsche Zeitung, 7. Juni 2011 Fraktur und Sütterlinschrift |
| nach oben | |
|
Rominte van Thiel Röttenbach |
Dieser Beitrag wurde am 09.06.2011 um 22.53 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#7844 Ein kleiner Liclhtblick, der hoffentlich die Leser etwas erhellt. Die Vorstellung von der "Nazi-Schrift" ist einfach nicht auszurotten. Etwas in der Richtung las ich erst neulich in einem ansonsten ganz klugen Beitrag eines jungen Autors. Das gipfelte dann in einer Formulierung so ähnlich wie: "Fehlte nur noch, daß sie ihre kruden Thesen in altdeutscher Fraktur zu Papier bringen". So ganz ist es aber Hitler auch nicht anzulasten. Noch in den 50er Jahren waren einige Bücher durchaus und auch selbstverständlich in Fraktur gedruckt – ohne daß es sich um etwas Historisierendes gehandelt hätte und ohne daß es jedem aufgefallen wäre. |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Kiel |
Dieser Beitrag wurde am 23.08.2011 um 18.29 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#8086 Die Presse, 14. Juli 2011 Online-Handel: Einmal vertippt, Millionen verloren Mangelnde Rechtschreibkenntnisse von Website-Betreibern sorgen für Skepsis bei den Kunden. Sie kaufen lieber woanders ein. Internetfirmen verlieren Millioneneinnahmen durch mangelnde Rechtschreibung. Zu diesem Befund kommt ein Online-Unternehmer in einem Interview mit BBC News. "99% der Kommunikation im Internet" laufe schriftlich ab, konstatiert Charles Duncombe, der mehrere Websites über Reisen, Handys und Kleidung betreibt. Korrekte Rechtschreibung sei wichtig für die Glaubwürdigkeit eines Online-Händlers. In einem Fall konnte Duncombe belegen, dass das Ausbessern eines Rechtschreibfehlers die Umsätze zu einer Website verdoppeln konnte. Schützenhilfe erhält Duncombe von William Dutton von der Oxford University. Während im Web auf Facebook und vergleichbaren Plattformen die Toleranz für Rechtschreibfehler höher sei, würden Nutzer bei kommerziellen Websites deutlich kritischer sein. "Wenn ein Konsument sich vor Spam oder Phishing fürchtet, könnte ein falsch geschriebenes Wort ein schwerwiegendes Problem sein", sagt Dutton. Offenbar gibt es in Großbritannien ein Problem mit den Rechtschreibkünsten, die im Bildungssektor vermittelt werden. Eine Studie besagt, dass 42 Prozent der Arbeitgeber nicht mit grundlegenden Lese- und Schreibfähigkeiten von Schul- und Collegeabsolventen zufrieden seien. Fast die Hälfte musste ihre Belegschaft in diesem Bereich trainieren, bevor die Ergebnisse befriedigend waren, berichtet die BBC. diepresse.com |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Kiel |
Dieser Beitrag wurde am 12.10.2011 um 22.18 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#8191 Der Tagesspiegel online, 11. Oktober 2011 „Kein Interesse an Schlagkraft“ Erich Thies, Generalsekretär a.D. der Kultusministerkonferenz, über das unpopuläre Gremium Herr Thies, „das billige Vergnügen, Witze über die KMK zu machen, gehört zu den wohl beliebtesten Formen intellektueller Selbstbefriedigung in Deutschland“, hat der einstige Präsident der Kultusministerkonferenz (KMK), Hans Joachim Meyer, einmal bitter gesagt. Warum wird die KMK so oft öffentlich verspottet? Meistens hat es die KMK mit komplizierten Themen zu tun, für die es eben keine einfachen Lösungen gibt. Das ist aber nur schwer zu vermitteln. Was war während Ihrer 13-jährigen Amtszeit in der KMK der dunkelste Moment? Die Diskussion um die Sommerferienregelung im Jahr 1999. Es ging um die Frage, wie man die Sommerferien der Länder so organisiert, dass weder alle zugleich Ferien machen noch sich die Sommerferien in Deutschland vom Mai bis in den Oktober ausdehnen. Ein glänzendes Beispiel für ein Problem, das nicht zur Zufriedenheit aller gelöst werden kann. Noch schlimmer war die emotionale Debatte um die Rechtschreibreform, die von einer Initiative der Ministerpräsidenten ausging. Im Nachhinein hat sich dann gezeigt, dass die Hysterie überflüssig war. Ich selbst schreibe „dass“ übrigens immer noch mit „ß“. Als Ministerpräsident löste Christian Wulff 2004 eine Krise aus. Er drohte, Niedersachsen werde aus der KMK austreten. Schließlich musste das Generalsekretariat auf seinen Druck hin 30 von 190 Stellen abbauen. Womit sind die verbleibenden vielen Menschen im Sekretariat eigentlich den ganzen Tag lang beschäftigt? Mit der politischen Koordination der KMK sind nur relativ wenige befasst; das wird gerne übersehen. Ein großer Teil kümmert sich um den Pädagogischen Austauschdienst, der den Austausch von Lehrern und Schülern mit dem Ausland organisiert. Ein anderer großer Teil arbeitet in der Zentralstelle für die Anerkennung ausländischer Bildungsnachweise. Beides sind zentralisierte Dienstleistungen für die Länder. Eltern sagen, die Vielfalt im Schulwesen erschwere Umzüge in ein anderes Land. Haben Sie selbst noch den Überblick über die vielen Schultypen, Sprachenfolgen und Abituranforderungen? Ich selbst habe den Überblick nicht, aber natürlich hat ihn das Sekretariat als Behörde. Allerdings steckt hinter dieser Kritik der Eltern auch oft nur die Frustration über Dinge, die in der Schule für die Kinder gerade schiefzulaufen scheinen. Tatsächlich ist der Wechsel zwischen zwei Schulen in derselben Stadt für die Kinder womöglich auch nicht leichter als der Wechsel von Land zu Land. Die Idee, dass darum jede Schule in Deutschland das gleiche Schulbuch benutzen soll, halte ich trotzdem für falsch. Ich finde es gut, wenn die Lehrer die besten Schulbücher aussuchen können. Jedes Land will das Rad offenbar allein erfinden. Am Ende gibt es 18 unterschiedliche Sprachtests für Vorschüler. Verhindert diese Kleinteiligkeit nicht die Durchschlagskraft der Reformen? Wenn die Tests gut wären, wäre es gleich, wie viele wir haben. Leider gibt es aber kaum belastbare Erkenntnisse über deren Wirksamkeit. Kein Land will hinter der KMK verschwinden. Jedes will mit seinem Eigengewicht vor seinen Wählern erscheinen. Darum ist eine schlagkräftige KMK gar nicht im Interesse der Länder. Und es ist ja auch nicht einzusehen, warum für Bremen immer gut sein soll, was für Bayern gut ist. Dann soll auch der Bund nicht über die Bildung entscheiden? Es muss möglich sein, ohne Umwege gemeinsam Schulen und Hochschulen zu finanzieren. Darum hoffe ich, dass das Kooperationsverbot fällt. Leider haben sich die Ministerpräsidenten ja vom Bildungsgipfel zurückgezogen. Das war eine einmalige Chance, gemeinsame Verantwortung für eine zentrale Zukunftsfrage unserer Gesellschaft zu beweisen! Würde die Bundesregierung den Ländern einfach einen Blankoscheck geben, wie sie es fordern, könnte es laufen wie oft: Da verspricht der Bau einer Autobahn kurzfristig mehr Arbeitsplätze als Investitionen in Bildung. Die Länder werben einander aggressiv Lehrer ab, die finanzschwachen Länder leiden am meisten darunter. Muss die KMK solchen Kannibalismus nicht verhindern? Nein, ein so wichtiger Beruf muss auch attraktiv bezahlt werden. Die Länder müssen diese Konkurrenz aushalten. Berlins Wissenschaftssenator Jürgen Zöllner hat gesagt, er schäme sich für die Tatenlosigkeit der KMK in der Lehrerbildung. Der Zustand der Lehrerbildung ist wirklich unverantwortlich. Dabei denke ich nicht an mögliche Mobilitätshindernisse für Studierende. Das eigentlich Schlimme ist doch, dass man die Lehramtsstudierenden den fachwissenschaftlichen Interessen von Professoren ausgeliefert hat. Und ihnen Integrationsleistungen abverlangt, die die Professoren selber nicht zu erbringen imstande sind. Die Universitäten scheren sich in der Regel nicht darum, welche Mathematik ein angehender Lehrer braucht. Dabei verdanken sehr viele Professoren ihre Stellen der Tatsache, dass so viele Studierende für das Lehramt studieren. Doch für die Universitäten wie für die Politik ist der Exzellenzwettbewerb eben wichtiger. Die Standards, die die KMK für die Lehrerbildung beschlossen hat, sind darum letztlich wirkungslos. Was ist zu tun? Die Politik hätte die Universitäten längst zwingen müssen, sich viel mehr um die Belange der Lehramtsstudierenden zu kümmern. Wie das geht, macht die TU München vor. Die Studierenden und Professoren sind dort einer „School of Education“ zugeordnet. Die kümmert sich nicht nur um die organisatorischen Dinge wie die Lehrerbildungszentren der Universitäten. Sie hat ihr gesamtes Angebot inhaltlich auf die fachlichen Bedürfnisse der künftigenLehrer zugeschnitten. Auch in die unübersichtliche Hochschulzulassung hat sich die KMK nicht eingemischt. Immer wieder bleiben Studienplätze leer oder können erst während des laufenden Semesters besetzt werden, obwohl großer Andrang herrscht. Das ist kein Versäumnis der KMK. Es gibt Schwierigkeiten mit der Software, die die Bewerbungen zentral über die Stiftung für Hochschulzulassung abwickeln soll. Darüber, wann das funktioniert, wage ich keine Prognose. Wäre es nicht einfacher, wenn die Hochschulen auf allgemeine Zulassungskriterien verpflichtet würden? Davon halte ich nichts. Die Hochschulen sollen ihre eigenen Kriterien anwenden, so wie wir es beschlossen haben. Was kommt als Nächstes auf Ihren Nachfolger Udo Michallik zu? Er muss daran arbeiten, dass die KMK die nach Pisa von ihr beschlossenen sieben Handlungsfelder weiter konsequent verfolgt. In der Lehrerbildung muss Druck aufgebaut werden. Genauso bei der Frage der Zulassung zum Studium. Die Fragen stellte Anja Kühne. ERICH THIES, geb. 1943, ist Professor emeritus für Erziehungswissenschaft an der HU. Von 1998 bis September 2011 war er Generalsekretär der Kultusministerkonferenz. (www.tagesspiegel.de) |
| nach oben | |
|
Manfred Riemer Mannheim |
Dieser Beitrag wurde am 14.10.2011 um 14.41 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#8195 "Und es ist ja auch nicht einzusehen, warum für Bremen immer gut sein soll, was für Bayern gut ist." Doch, das sehe ich sehr wohl ein. Meiner Meinung nach muß man mal das Gegenteil betrachten: Es ist überhaupt nicht einzusehen, warum für Bremen schlecht sein soll, was für Bayern gut ist. |
| nach oben | |
|
Manfred Riemer Mannheim |
Dieser Beitrag wurde am 17.10.2011 um 21.36 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#8211 Der DLF brachte am 15.10. vormittag folgendes, vor dem Gedankenstrich hier sinngemäß (aus der Erinnerung) wiedergegeben, danach wörtlich: Auf der einen Seite das saubere, aufgeräumte Bayern, auf der anderen Seite das kaputte, vom Kommunismus gezeichnete Böhmen – diese Gleichung geht schon längst nicht mehr auf. Was ist eigentlich eine Gleichung? |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Kiel |
Dieser Beitrag wurde am 24.10.2011 um 18.45 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#8224 www.digitalfernsehen.de, 24. Oktober 2011 Medientage München: Forderung nach neuen Mediengesetzen Auf den Medientagen München haben die Teilnehmer Chancengleichheit im weltweiten Wettbewerb gefordert. Es müssten neue Mediengesetze geschaffen werden, die sowohl für internationale als auch für nationale Medienunternehmen gelten. Die neue Rechtschreibung solle gleiche Rahmenbedingungen für Fernsehen und Online-Angebote schaffen, ging aus einem abschließenden Resümee der Medientage vom Freitagabend hervor. Zudem müssten auch die Bereiche Datenschutz, Medienkonzentration- und Urheberrecht neu geordnet werden. Staatsminister Marcel Huber, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, forderte, die deutsche Medienregulierung den veränderten Rahmenbedingungen des Online-Zeitalters anzupassen. Vor allem das Medienkonzentrationsrecht müsse modernisiert und von seiner starken Fixierung auf TV-Einschaltquoten gelöst werden. Das Zusammenwachsen von TV und Internet mache es notwendig, global operierende Unternehmen in die Rundfunkordnung einzubeziehen und die Bestimmungen für klassische Medienbetriebe zu deregulieren. Im Wettbewerb zwischen klassischen und neuen Medienanbietern sollten "faire Spielregeln" geschaffen werden. Das beziehe auch Kreative ein, die ihre Inhalte gegen Internetpiraterie schützen müssen. [. . .]. (www.digitalfernsehen.de) |
| nach oben | |
|
Urs Bärlein * |
Dieser Beitrag wurde am 25.10.2011 um 15.16 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#8225 Das bedeutet wohl: Niemand soll mehr einen Wettbewerbsvorteil daraus ziehen können, anders als reformiert zu schreiben. Das Ansinnen ist entlarvend. Wäre Reformdeutsch vorteilhaft oder wenigstens nicht nachteilig, bedürfte es keiner gesetzlichen Privilegierung, um Chancengleichheit herzustellen. Vielmehr wäre selbst schuld, wer seinen Vorteil nicht wahrnimmt, zumindest müßte Rechtschreibung als wettbewerbsneutral angesehen werden. |
| nach oben | |
|
Oliver Höher Braunschweig |
Dieser Beitrag wurde am 25.10.2011 um 15.31 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#8226 Ich habe das noch nicht so ganz verstanden, Herr Bärlein. Wie kann man denn aus einer Rechtschreibung, die nicht gesetzlich verpflichtend ist, einen Wettbewerbsvorteil ziehen? (Einen wirklichen Wettberwerbsvorteil hat man zudem nur, wenn man in einer bewährten Qualitätsorthographie schreibt. Aber das nur nebenbei!) Und wie kann eine Rechtschreibung Rahmenbedingungen schaffen? Da das Urteil des Bundesverfassungsgerichts jedoch eindeutig ist, kann man diesen Bubenstreich, durch eine Hintertür die Reformschreibung zu privilegieren, nur als gesetzeswidrig ansehen. Aber im Zeitalter der Staatstrojaner kümmern sich Politiker ja bekanntlich nicht mehr um die Karlsruher Vorgaben. |
| nach oben | |
|
Roger Herter Basel |
Dieser Beitrag wurde am 25.10.2011 um 16.56 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#8227 Hier geht's wohl nicht um Orthographie. Der Artikelschreiber wird an Rechtsetzung gedacht haben, wobei ihm Gesetzschreibung in die Quere gekommen ist. |
| nach oben | |
|
Urs Bärlein * |
Dieser Beitrag wurde am 25.10.2011 um 17.01 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#8228 Die Aussage, die neue Rechtschreibung solle Rahmenbedingungen schaffen, ist offenkundig unsinnig, das sehe ich auch so. Gemeint kann nur sein, daß die Reformschreibung selbst Rahmenbedingung werden soll. Ein Wettbewerbsvorteil läßt sich gewiß nicht aus ihr ziehen. Andernfalls müßte man sie verbieten, um Chancengleichheit herzustellen, jedenfalls unter der Voraussetzung, daß ihre Verwendung manchen Marktteilnehmern verwehrt wäre. Entfällt diese Voraussetzung, kann es auch keinen wettbewerbsrechtlichen Regelungsbedarf geben, jedenfalls dann nicht, wenn es keine bessere Rechtschreibung gibt. Es gibt aber eine. Das ist der Punkt. |
| nach oben | |
|
Urs Bärlein * |
Dieser Beitrag wurde am 25.10.2011 um 17.16 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#8230 Vielen Dank, Herr Herter. Ihre Erklärung leuchtet ein. |
| nach oben | |
|
Wolfram Metz Den Haag, Niederlande |
Dieser Beitrag wurde am 25.10.2011 um 21.17 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#8232 Es handelt sich offenbar um eine Paraphrasierung der folgenden Sätze aus der Abschlußpressemitteilung: »Deutschlands Medienwirtschaft benötigt Chancengleichheit im globalen Wettbewerb: Erster Schritt muss dabei ein neuer Rechtsrahmen sein, der gleichermaßen für internationale Konzerne wie nationale Medienunternehmen gilt. Dies ist nach drei Kongresstagen ein wesentliches Ergebnis der 25. MEDIENTAGE MÜNCHEN. Das neue Regelwerk sollte außerdem auch gleiche Rahmenbedingungen für Fernsehen und Online-Angebote schaffen. Neu geordnet werden müssten auch die Bereiche Datenschutz, Medienkonzentrations- und Urheberrecht.« |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Kiel |
Dieser Beitrag wurde am 18.11.2011 um 19.17 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#8317 Mitteldeutsche Zeitung online, 17./18. November 2011 Vorlesetag Wer Geschichten lauscht, kann seine Noten verbessern Von Antonie Städter BITTERFELD-WOLFEN/MZ. "Lies!" An diese gut gemeinte Aufforderung ihrer einstigen Lehrerin kann sich Anne Bär noch gut erinnern. Damals war sie Grundschülerin und hatte Probleme mit der Rechtschreibung. Fortan aber "habe ich alles in mich reingelesen", erinnert sich die 49-Jährige. Nicht nur der Rechtschreibung wegen - sondern, weil sie Gefallen daran fand. Mit dem Ergebnis: "Es hat geholfen." In gewisser Weise übernimmt Anne Bär in Bitterfeld-Wolfen nun ebenso die Rolle der Anstifterin, was das Lesen angeht: Vor zwei Jahren hatte sie, damals arbeitslos, nach einer ehrenamtlichen Aufgabe gesucht. Als sogenannte Engagement-Lotsin rief sie ein Lesepaten-Projekt ins Leben, das sie heute im Rahmen der Bürgerarbeit koordiniert. Regelmäßig geht sie - wie derzeit sechs andere Paten der "Lesewölfe" - vor allem in Kindereinrichtungen, um dort vorzulesen. "In der heutigen Zeit der Computer möchte ich den Kindern das Buch wieder näher bringen", sagt sie. Und tut damit genau das, was auch der bundesweite Vorlesetag, der nun zum achten Mal veranstaltet wird, erreichen soll: Lust auf Literatur machen. Tausende Menschen lesen heute an allen denkbaren Orten - von der Kita bis zur Bibliothek - anderen ihre Lieblingsgeschichten vor. Lesende Landesminister Darunter sind etliche Promis und Politiker, von Anne Will bis Uli Hoeneß, von Philipp Rösler bis Uschi Glas. Auch in Sachsen-Anhalt wird heute häufig öffentlich zum Buch gegriffen - zum Beispiel von vielen Landesministern. Rund 11 000 Aktionen wurden deutschlandweit angemeldet, heißt es bei den Organisatoren des Vorlesetages, der eine Initiative der Stiftung Lesen, der Wochenzeitung "Die Zeit" und der Deutschen Bahn ist. Gerade haben diese eine Studie zur Bedeutung des Vorlesens veröffentlicht, deren Fazit vielversprechend klingt: Je mehr einem Kind vorgelesen wird, desto besser entwickelt es sich. Die Unterschiede zeigen sich in verschiedenen Bereichen - von Leseverhalten und Schulerfolg bis hin zu Freizeitgestaltung und sozialer Kompetenz. So offenbart die Studie, für die 500 Kinder und Jugendliche von 10 bis 19 Jahren befragt wurden, nicht nur positive Effekte von Vorlesen auf die eigene Lesefreude - sondern auch auf die Noten in Mathe und Deutsch. Zudem wird das Klischee der sozial isolierten Leseratte widerlegt: Der Anteil derer, die mindestens einmal pro Woche Sport treiben, war bei denjenigen, denen vorgelesen wurde, deutlich höher. Den Kindern, die an diesem Mittwochnachmittag zu den "Lesewölfen" ins Wolfener Mehrgenerationenhaus gekommen sind, werden solche Statistiken egal sein. Kaum nimmt Anne Bär das Geschichten-Buch in die Hand, sehen und hören sie nichts anderes. Der zehnjährige Pascal, gerade hüpfte er noch auf den Sitzsäcken umher, lümmelt sich nun darauf mit den anderen. Und schaut versonnen in die Luft, als Anne Bär eine Geschichte rund um Weihnachtswünsche vorliest. Kinder sind Stammpublikum "Es gibt viele Kinder, die jedes Mal herkommen", erzählt die "Lese-Tante", wie sie hier von den Jüngeren genannt wird. Die Bücher für das Lesepaten-Projekt kann sie sich kostenlos in der Bibliothek ausleihen. Dass das Vorlesen die eigene Lust am Lesen fördern soll, kann sie bestätigen: "Die Kinder hier reißen sich regelrecht darum, selbst vorzulesen." Das sei doch wunderbar, sagt sie, "dass sie keine Scheu davor haben". Am beliebtesten seien - wie könnte es anders sein - Tiergeschichten und Geschichten zum Lachen. Extern: Vorlesetag (www.mz-web.de) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Kiel |
Dieser Beitrag wurde am 05.01.2012 um 14.02 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#8506 www.magnus.de, 28. Dezember 2011 Typosquatter nutzen URL-Tippfehler aus Die Finger fliegen über die Tastatur, doch die Rechtschreibung fällt der Geschwindigkeit gelegentlich zum Opfer: Was in einer E-Mail oder einem Chat keine Folgen hat, kann bei der Eingabe einer Web-Adresse unangenehme Überraschungen bergen. Sogenannte Typosquatter machen sich Tippfehler in URLs zunutze, um auf eigene Websites zu verlinken. Die enthalten nicht selten unerwünschte Inhalte oder gar Phishing-Software. Doch was genau ist Typosquatting? Frei übersetzt bedeutet der Begriff so viel wie "Tippfehlerdomain" und bezeichnet eine Webadresse, die trotz falscher Rechtschreibung auf eine Seite verlinkt. Gibt man beispielsweise www.acebook.de in den Browser ein, führt der Link nicht zum Sozialen Netzwerk Facebook, sondern zu einer Umfrage. Das Perfide: Die Seite kopiert die Facebook-Optik und suggeriert so, Teil des Netzwerkes zu sein. Das soll Vertrauen beim User wecken und ihn zur Teilnahme verleiten. Dieser Methode bedienen sich zahlreiche Typosquatter. Allerdings können hinter den vermeintlich vertrauenswürdigen Websites Schadprogramme, Trojaner, Viren, Spambots oder Phisher - Datendiebe - lauern. Besonders ärgerlich ist es, wenn direkt zu pornografischen Inhalten weitergeleitet wird - insbesondere, wenn Kinder davon betroffen sind. Woran ist eine Typosquatting-Seite zu erkennen? Zuallererst sollte man stutzig werden, wenn nach Eingabe der Webadresse nicht die gewünschte Homepage erscheint. Eine Überprüfung der URL in der Browserzeile ist nun geboten. Häufig ist es nur ein Buchstabendreher, der einer korrekten Weiterleitung im Wege steht. Viele Typosquat-Sites sind sehr leicht als solche zu entlarven: Teilweise werden Gewinnspiel-Offerten in schlechtem Deutsch unterbreitet ("Glückwünsche! Sind Sie ein Gewinner heute? Bitte wählen Sie einen Preis, und geben Sie Ihre E-Mail auf der nächsten Seite."), oder das geklaute Logo sticht ins Auge - wie beispielsweise bei der Eingabe von www.wiipedia.org anstelle von www.wikipedia.org. Oft führen fehlerhafte URLs auch zu sogenannten Suchseiten (Beispiel: www.gmy.de statt www.gmx.de), die eine Fülle an Verlinkungen anbieten. Auf keinen Fall sollte jedoch etwas auf der unerwünschten Website angeklickt werden. Es fällt auf, dass insbesondere beliebte, namhafte Internetauftritte wie Facebook, Wikipedia, GMX, Apple oder Microsoft von Typosquatting betroffen sind: Da die Sites von einer Vielzahl an Usern aufgerufen werden, ist die Wahrscheinlichkeit von Tippfehlern entsprechend hoch - und die Gelegenheit, auf Kosten der Surfer Profit zu machen, äußerst günstig. Doch viele Website-Inhaber schützen sich gegen den Mißbrauch ihrer Domain, indem sie falsch geschriebene URLs auf ihr Unternehmen registrieren lassen. Das beste Beispiel hierfür ist www.google.de: Egal, ob www.goolge.de, www.googel.de oder www.gogle.de in der Browserzeile steht - die Adresse führt immer zur Startseite der Suchmaschine. Wer selbst herausfinden möchte, ob eine Webadresse zu Typosquattern verlinkt, kann dies auf paderbutze.de/typosquat kontrollieren: Die fragliche URL wird einfach in das Suchfenster eingetippt, woraufhin der Generator sämtliche möglichen Tippfehler ausspuckt. Neben den IP-Adressen der Server, auf denen die jeweilige Website verwaltet wird, zeigt das Suchergebnis auch an, ob die Domain bereits bei der Denic (Deutsches Network Information Center) registriert ist. Einen standardisierten Schutz vor Typosquatting gibt es nicht. Internet-Sicherheitsprogramme filtern zwar viele Seiten, können aber nicht alle erkennen. Am sichersten ist noch immer eine Überprüfung der Schreibweise der URL sowie ein gesundes Misstrauen gegenüber fragwürdigen Webauftritten. (www.magnus.de bzw. Yahoo-Cache, außerdem auch unter www.baden-online.de) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Kiel |
Dieser Beitrag wurde am 06.01.2012 um 15.15 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#8514 www.derwesten.de, 30. Dezember 2011 Gemeindeordnung Zusätze zu Städtenamen - Erste Anträge aus Hagen, Attendorn und Solingen [...] Hochschule ein "Herausstellungsmerkmal" für Hagen Die Hochschule sei ein „Herausstellungsmerkmal“, begründet Hagens Oberbürgermeister Jörg Dehm seinen Antrag: „Keine andere Institution wird bundesweit in ähnlicher Weise mit dem Namen der Stadt Hagen verbunden.“ Vor der Gesetzesänderung in NRW hatten die Hagener in einem bundesweit beachteten „Schildbürgerstreich“ ihren Ortsschildern den Namenszusatz „Stadt der FernUniversität“ beigefügt. Im Sommer mussten diese wieder entfernt werden. Im Innenministerium hatte man sich auch an dem orthografisch falschen und werbenden großen „U“ gestoßen. Diesmal klingt es aus Düsseldorf nachweihnachtlich milde: „Grundsätzlich muss der Beiname den Regeln der Rechtschreibung entsprechen“, sagt Sprecherin Birgit Axler. „Aber wir prüfen, ob die Schreibweise schon so lange benutzt wird, dass sie als gebräuchlich gelten kann.“ Bleibt die Frage, ob sich Kommunen in Zeiten knapper Kassen mit Beinamen einen finanziellen Klotz ans Bein binden. „Auf keinen Fall“, sagt Attendorns Bürgermeister Hilleke. „Wir rüsten die Schilder nach und nach im Rahmen notwendiger Erneuerungen und Instandhaltungen um.“ (www.derwesten.de) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Kiel |
Dieser Beitrag wurde am 01.05.2012 um 17.39 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#9025 Der Standard, 24. April 2012 "Es gibt einen Fokus auf österreichisches Deutsch" Ruth Wodak über Fehler in Maturaarbeiten und die Abgrenzung von Deutschland "Heute schreibt man Weblogs und E-Mails statt Tagebücher und Briefe", sagt die Sprachwissenschaftlerin Ruth Wodak. Sie hat eine Studie über den Wandel der deutschen Sprache erstellt und unter anderem Maturaarbeiten aus dem Jahr 1970 mit jenen von 2010 verglichen. Das Ergebnis: Die Sätze sind heute kürzer und die Verwendung von Anglizismen häufiger, es gibt mehr Fehler bei Satzzeichen und die Schülerinnen und Schüler haben Probleme, Redewendungen und feste Fügungen korrekt zu verwenden. Wodak sieht darin aber nicht nur Negatives: "Oft herrscht diese Angst vor, dass die Sprache untergeht. Das stimmt so nicht, sondern sie wird anders." Das bringe auch viele Vorteile, so Wodak. Warum sie die seltenere Verwendung des Genitivs als "Abgrenzungsphänomen im Zuge der österreichischen Identitätsbildung" bezeichnet und was Journalistinnen und Journalisten heute anders machen als 1970, sagt sie im Interview mit derStandard.at. derStandard.at: Um den Wandel der deutschen Sprache festzustellen, haben Sie Maturaarbeiten von 1970 mit jenen von 2010 verglichen. Was machen 18-Jährige heute anders? Wodak: Die Sätze sind kürzer geworden, der Wortschatz ist weniger elaboriert. Es haben viele Anglizismen Eingang gefunden. Das ist gut erklärbar durch die technische Innovation. "E-Mail" wäre so ein typisches neues Wort, um ein Beispiel zu nennen. derStandard.at: Die Verwendung der Anglizismen ist ein Zeichen der Zeit - übertreiben es die Schüler damit? Wodak: Es kommt natürlich auch sehr auf den Themenbereich an. Manchmal werden neue Begriffe notwendig. Wichtig ist auch festzustellen, dass die Sätze der SchülerInnen zwar kürzer geworden sind, aber auch komplexer. Das messen wir an der Vielzahl der Relativsätze oder der untergeordneten Sätze. Allerdings ist es schwer zu interpretieren, warum das so ist. derStandard.at: Die Schüler verwenden mehr Schachtelsätze? Wodak: Ja, und das ist natürlich per se weder gut noch schlecht. Gleichzeitig gibt es eine Abnahme an festen Fügungen und Phraseologismen und ein Zurücktreten der Bildungssprache als stilistischem Orientierungspunkt. derStandard.at: Stattdessen gibt es also mehr Umgangssprache? Wodak: Ja, ganz deutlich manifestiert sich zum Beispiel der Genitivschwund. Das ist im österreichischen Deutsch ja im Prinzip auch okay. Zum Beispiel sagt man "Die Zunahme von den Problemen" statt wie früher auf Hochdeutsch "Die Zunahme der Probleme". derStandard.at: Woran liegt das, dass die Genitivkonstruktionen unattraktiver werden? Wodak: Das ist ein Element des österreichischen Deutsch. Es gibt hier einen Wandel, den wir seit 1945 beobachten, ein Abgrenzungsphänomen im Zuge der österreichischen Identitätsbildung: Es gibt eine Fokussierung auf das sogenannte österreichische Deutsch. Der Genitivschwund wird also als Norm akzeptiert. Das ist ein akzeptierter Wandel, begründet durch die Identitätsbildung ab 1945. Es ist interessant und wichtig, solche Bezüge herzustellen. derStandard.at: In Ihrer Studie schreiben Sie, die Lehrer würden weniger streng korrigieren als 1970. Woran liegt das? Wodak: Das hängt auch mit der Akzeptanz der österreichischen Norm zusammen. Aufgrund der neuen theoretischen Entwicklungen innerhalb der Sprachwissenschaft wird man mehr auf Textkompetenz geschult als nur wie früher auf das Feststellen von Rechtschreibfehlern. Man hat auch den richtigen Sprachgebrauch heute mehr im Auge als nur punktuelle Rechtschreibung. Natürlich bleibt die Rechtschreibung sehr wichtig, aber eine adäquate Textsortenkompetenz ist mindestens ebenso wichtig. Man muss wissen, wie man einen Brief richtig schreibt, wie man eine Rechnung stellt, wie man eine Schilderung im Gegensatz zu einer Bildbeschreibung im Gegensatz zu einer Erzählung usw. formuliert. Auf diese Sachen wird heute wesentlich mehr Wert gelegt. derStandard.at: Gibt es eine fehlende Disziplin der Schülerinnen und Schüler - etwa beim Erlernen der Zeitenfolge? Wodak: Die Zeitenfolge hat sich überall, auch in anderen Sprachen, verflacht. Zeitenfolge, Konjunktivbildung - der richtige Gebrauch solcher grammatischer Elemente ist in vielen Bereichen zurückgegangen. Auch im Englischen oder im Französischen. Wir sind in unserem Sprachverhalten insgesamt "mündlicher" geworden. Es gibt natürlich noch sehr formale Situationen: Formbriefe, Prüfungen, Zertifikate, das ist klar. Insgesamt ist man aber heutzutage dialogischer und adressatenorientierter. Das ist daher wirklich spannend, wenn man Geschäftsbriefe oder Geschäftsberichte von früher mit den heutigen vergleicht. Heute werden Kundinnen und Kunden persönlich angesprochen. Früher war das ein trockener und sachlicher Bericht. derStandard.at: Welchen Faktor spielt die Schnelllebigkeit der heutigen Zeit? Wodak: Natürlich ist das ein wichtiger Faktor. Sprache hat sich verändert, seit neue Genres wie E-Mail und Blogs etwa in die Kommunikation Einzug gehalten haben. Früher gab es Tagebücher und Liebesbriefe. Diese Genres werden jetzt seltener; es wird alles wesentlich stärker auf elektronische Kommunikation verlagert. Heute schreibt man Weblogs und E-Mails statt Tagebücher und Briefe. derStandard.at: Das klingt alles oft sehr negativ. Hat diese schnelle Kommunikation nicht oft auch Vorteile? Wodak: Genau. Das ist mir sehr wichtig, das auch so zu sehen. Es ist nicht nur der Fall, dass wesentliche kommunikative Faktoren wegfallen. Oft herrscht diese Angst vor, dass die "deutsche Sprache" untergeht. Das stimmt so nicht, sondern sie wird eben anders. Die wesentlichen Funktionen bleiben erfüllt, sie haben sich nur teilweise verändert. derStandard.at: Neben der Zunahme von Anglizismen sind bei den Schülern auch Fehler bei den Satzzeichen häufiger geworden. Welche Rolle spielen die neuen Medien bei der Veränderung der Sprache? Wodak: Natürlich haben die neuen Medien Einfluss. Aber es gibt verschiedene Erklärungsmodelle, warum Satzzeichen oft ein Problem darstellen. Aufgrund der letzten Rechtschreibreform kennt man sich manchmal einfach nicht mehr aus. derStandard.at: Würden Maturanten von 2010 die Matura im Jahr 1970 bestehen? Wodak: Manche ja, manche nein. Das kann man schwer kontextlos vergleichen. Heute gibt es einen ganz anderen Wissensstand. Vielleicht setzt man heute andere Prioritäten, aber insgesamt würden die meisten SchülerInnen sicher die Matura bestehen. derStandard.at: Sie haben ja nicht nur Maturaarbeiten untersucht, sondern auch Zeitungen von 1970 mit jenen von 2010 verglichen. Bestätigt sich der Wandel der Sprache in den Medien? Wodak: Die Deutsch-Maturaarbeiten waren nur ein kleiner Teil unserer Untersuchung. Mein Ausgangskonzept war, dass wir in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft verschiedene Textsorten untersuchen. Ich bin davon ausgegangen, dass sich die Sprache kontextbedingt jeweils unterschiedlich wandelt. Meine Hypothese war also, dass sich Sprachverhalten und Sprachgebrauch im Bildungsbereich anders gewandelt haben als im Medienbereich, und im Medienbereich wiederum jeweils unterschiedlich in den verschiedenen Ressorts. Es gibt stark themenbezogene und bereichsbezogene Unterschiede. derStandard.at: Hat sich Ihre These bestätigt? Wodak: Ja, man kann nicht allgemein von einem gleichförmigen und gleichzeitigen Wandel sprechen. Es ist tatsächlich so, dass der Wandel ganz unterschiedlich in den unterschiedlichen Textsorten zu bemerken war. derStandard.at: Was machen Journalisten heute anders als 1970? Wodak: Die Sprache in manchen Zeitungen ist narrativer und weniger komplex geworden. Das gilt aber auch nicht für alle Bereiche. In den Kulturnachrichten ist sie zum Beispiel komplexer geworden. Hier werden mehr Fremdwörter verwendet als in Außen- und Innenpolitik. Natürlich stellt sich die Frage, warum das so ist. Ob die Intellektualität oder weitreichenderes Wissen vor allem im Kulturbereich zählt? Ob die Redakteure hier anders geschult werden? Da sind noch viele Fragen offen, wo wir mehr Forschung brauchen. derStandard.at: Sie haben auch herausgefunden, dass es heute mehr Bindestrich-Komposita "im Stil der 'Kronen Zeitung'" gibt. Was genau kann man darunter verstehen? Wodak: Es werden mehr Bindestrich-Komposita verwendet und dadurch auch neue Begriffe geschaffen. "Kinderporno-Verdacht" ist ein gutes Beispiel. Eigentlich meint man damit "Verdacht auf Kinderporno". Die Zuordnung ist bei diesen Bindestrich-Komposita oft nicht so ganz einfach. Es ist manchmal schwierig festzustellen, welche Präposition durch einen Bindestrich quasi ersetzt wurde: Verdacht für, auf, zu ...? Das ist eine Verkürzung, die man erst richtig entschlüsseln muss. derStandard.at: Hier spielen wahrscheinlich auch Platzgründe eine Rolle. Wodak: Das ist sicher nicht das ausschlaggebende Moment. Auch hier spielt die Vermündlichung unserer Sprache eine Rolle. derStandard.at: In der "Kronen Zeitung" haben auch vulgäre Ausdrücke zugenommen. Wodak: Ja, das ist auch ein Zeichen dafür, dass mehr Umgangssprache einfließt. Begriffe, die man früher nicht öffentlich verwendet hätte, finden plötzlich Eingang. Das weist auf eine gewisse Veränderung von Normen hin. derStandard.at: Sie haben die "Presse" mit der "Krone" verglichen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass sie sich annähern. Woraus wird das ersichtlich? Wodak: Das narrative Element hat in der "Presse" mehr Eingang gefunden. Die "Krone" hat immer schon mehr Geschichten erzählt. Da gab es schon lange ein Verschwimmen der Grenzen zwischen Geschichte und Bericht. derStandard.at: Der narrative Journalismus ist hilfreich, um Sachverhalte leichter transportieren zu können. Wodak: Natürlich, das ist adressatenorientierter und wirkt auch ein bisschen bunter. Man kann direkte Rede einflechten. Die Texte sind sicher lesergerechter als ein eher trockener, unpersönlicher, im Passiv geschriebener Bericht. derStandard.at: Würden Sie manchen Journalisten einen Deutschkurs empfehlen? Wodak: Ich würde eher empfehlen, mehr darauf zu achten, welches Hintergrundwissen Leserinnen und Leser haben. Journalisten sollten sich die Frage stellen, was man dem Leser oder der Leserin erklären muss. Wie macht man komplexe Sachverhalte möglichst verständlich? Zum Beispiel bei Nachrichten über die Finanzkrise. Die Vermittlung ist oft tatsächlich schwierig. derStandard.at: Würden Sie Schülern raten, wieder mehr zu lesen, um zum Beispiel Phraseologismen oder Redewendungen besser zu beherrschen? Wodak: Ja, es wäre wichtig, die Freude am Lesen zu unterstützen. Wobei Lesen im Internet auch als Lesen zu werten ist. Die Beschäftigung mit Literatur sollte einen wichtigen Platz im Leben einnehmen. (Rosa Winkler-Hermaden, derStandard.at, 24.4.2012) Ruth Wodak (62) ist Professorin für Sprachwissenschaft an der Universität Wien und an der Lancaster University. Für die Studie "Wandel der Sprache: Verfall, Veränderung oder Wachstum" wurden 138 Maturaarbeiten untersucht. (derstandard.at) |
| nach oben | |
|
Paul Westrich Kusterdingen |
Dieser Beitrag wurde am 26.06.2012 um 08.17 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#9168 Die Galapagos-Riesenschildkröte "Lonesome George" ist gestorben. Im Gegensatz zu den BBC News hat es allerdings keine der größeren Online-Zeitungen (Focus, Spiegel, Süddeutsche, FAZ, Welt, Stern) geschafft, korrekt zu berichten. Entweder wurde nicht zwischen Art und Unterart unterschieden ("Die letzte ihrer Art", "die Welt um eine Species ärmer") oder der wissenschaftliche Name der Unterart wurde falsch wiedergegeben (Chelonoidis abingdoni statt Chelonoidis nigra abingdoni) oder beides ist falsch. Sorgfalt sieht anders aus. |
| nach oben | |
|
Manfred Riemer Mannheim |
Dieser Beitrag wurde am 30.06.2012 um 22.59 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#9180 Katie Holmes lässt sich von Tom Cruise scheiden Daß sich die FAZ (hier am 30.6.12 auf Seite 9) für solche Artikel nicht zu schade ist? Ich meine, es gibt doch genügend Klatsch- und Tratschblätter am Bahnhofskiosk, und beim Friseur oder im Wartezimmer beim Arzt kann man sie sogar umsonst lesen. Mal sehen (es ist immerhin die FAZ), ob es nicht doch was Bemerkenswertes gibt: ... Holmes hatte am 18. April 2006 Tochter Suri zur Welt gebracht, im November 2006 heiratete das Paar im italienischen Bracciano nach Scientology-Ritus statt. Für den inzwischen 49 Jahre alten Cruise wäre es die dritte Scheidung. Holmes ist 16 Jahre älter als seine dritte Frau Katie Holmes. (Die Fettmarkierungen nach der Überschrift sind von mir.) |
| nach oben | |
|
Manfred Riemer Mannheim |
Dieser Beitrag wurde am 09.08.2012 um 16.05 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#9270 Was das Denglisch so für Blüten treibt ... Warum muß man aber auch unbedingt so ein dusseliges Wort wie Point-of-Contact in einem deutschen Text benutzen und dann auch noch mit Bindestrichen durchkoppeln? Aus einer internen E-Mail, gerade erhalten: Im Rahmen dieser Info Session möchten wir Euch, die Point-of-Contacts ..., über Einzelheiten der Programme informieren. |
| nach oben | |
|
Robert Roth Gau-Algesheim |
Dieser Beitrag wurde am 16.08.2012 um 22.08 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#9313 Der Sturm Tod eines Kritikers Nr. 2. |
| nach oben | |
|
Manfred Riemer Mannheim |
Dieser Beitrag wurde am 28.09.2012 um 21.54 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#9488 zu 70#3446 und 70#3454, Geringschätzung des Deutschen durch Deutsche: In der Stadtwaage Bremen (Wikipedia: "Das Gebäude enthält heute als Kulturhaus Stadtwaage der Sparkasse Bremen einen Veranstaltungssaal und ist Sitz der Günter-Grass-Stiftung und der Deutschen Kammerphilharmonie.") gibt es eine Ausstellung zu Günter Grass. Stark hervorgehoben auf einer Wandtafel ist dort ein Zitat aus der Rheinischen Post vom 18.3.2007, worin es u. a. heißt: Alle Kritik ließ ihn nicht die Sprache verschlagen. ... Deutlich wird, Dank der sprachlichen Ausdruckskraft, wie sehr Grass gelitten hat unter der Berichterstattung. |
| nach oben | |
|
Matthias Künzer Herzogenrath |
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2013 um 13.50 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#9927 «Warteschleife: Fahrkarten kaufen - ein Kinderspiel Von Tom König Kritiker halten das Tarifsystem der Deutschen Bahn für schlimmer als Steuersystem und Rechtschreibreform zusammen. Dabei ist Bahnfahrkarten kaufen kinderleicht. Man darf nur kein Kind sein.» Einleitung zu Artikel über Fahrkartenkauf. |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Kiel |
Dieser Beitrag wurde am 07.03.2013 um 17.50 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#10106 Spiegel online / Schulspiegel, 22. November 2012 Britische Schule: Rechtschreibprüfer für Lehrer gesucht Nicht nur in einigen Schülerdiktaten wimmelt es von Fehlern. Auch Lehrer stolpern manchmal über die Regeln der Orthografie. Damit das nicht zu oft passiert, hat eine Schule in Großbritannien eine Stelle ausgeschrieben: Rechtschreibprüfer für Lehrertexte. Komma oder kein Komma, "then" mit E - oder doch lieber mit einem A? Rechtschreibung ist eine verflixte Sache, nicht nur für Schüler. Auch Lehrer tun sich damit öfters schwer. Eine Schule in Großbritannien begegnet dem Problem auf resolute Weise: Sie machte sich auf die Suche nach einem Rechtschreibprüfer - für Lehrer. Die Stelle sei auf der Homepage der Northgate High School in Ipswich nordöstlich von London ausgeschrieben gewesen, berichtete unter anderem die Tageszeitung "The Telegraph" am Mittwoch. Erfolgreiche Bewerber würden "Rechtschreibfehler, schlechte oder fehlende Zeichensetzung und falsche Großschreibung" korrigieren und "schwache Grammatik" in den Berichten verbessern, die Lehrer regelmäßig an die Eltern verschickten, hieß es demnach in der Anzeige. Die Schule wollte sogar ein ganzes Rechtschreibteam rekrutierten, berichtete die BBC. Jeder angenommene Bewerber werde an 15 bis 20 Tagen im Jahr gebraucht und solle 14 Pfund, umgerechnet etwa 17 Euro, pro Stunde bekommen. Es gehöre auch zu seinen Aufgaben, besonders rechtschreibschwachen Lehrern Feedback zu geben und "taktvoll Strategien vorzuschlagen, die ihnen helfen, sich zu bessern". Schulleiter nimmt seine Kollegen in Schutz Am Donnerstag war die Ausschreibung auf der Homepage nicht mehr zu finden. Die Schule wollte sich nicht dazu äußern, wie viele Rechtschreibprüfer sie sucht und ob der Job inzwischen schon vergeben sei. In einer Stellungnahme wehrte sich Schulleiter David Hutton gegen die Vermutung, dass sein Kollegium kein korrektes Englisch beherrsche. Die Lehrer an der öffentlichen Schule seien "sehr hochkarätig" und produzierten gemeinsam jedes Jahr Tausende "gut geschriebener Kommentare", die die Eltern über den Fortschritt ihrer Kinder informierten. "Ein letzter Qualitätscheck vor der Veröffentlichung zeigt lediglich das hohe Maß an Professionalität, nach dem wir streben." Im Internet kassierte die Schule einige Häme. "Wie können Sie erwarten, dass Schüler sich um korrekte Grammatik, Rechtschreibung etc. scheren, wenn nicht einmal die Lehrer das ohne Hilfe können?", schrieb eine Leserin der Regionalzeitung "Ipswich Star". Andere Internetnutzer nahmen die Lehrer in Schutz. Bei so viel Arbeit passierten schnell kleine Fehler, schrieb einer. Es sei deshalb wichtig, offizielle Dokumente gegenlesen zu lassen. (www.spiegel.de) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Kiel |
Dieser Beitrag wurde am 12.06.2013 um 17.39 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#10273 Bildungsklick, 12. Juni 2013 (Pressemeldungen) Rechtschreibung ist sexy! Glanzvolles Finale des Duden-Jungjournalistenwettbewerbs im ARD Hauptstadtstudio in Berlin Berlin, 12.06.2013 Beim Jungjournalistenwettbewerb "Duden Open 2012/2013" wurde heute (11.06.2013) im ARD Hauptstadtstudio in Berlin Simon Oberbichler aus Schwaz/Österreich zum Sieger gekürt. In einem spannenden Finale der besten neun Teilnehmer konnte er sich gegen die Konkurrenz durchsetzen und wurde als bester Nachwuchsjournalist des Wettbewerbs ausgezeichnet. Während zweier spannender Diskussionen zum Thema "Welchen Stellenwert hat korrekte Sprache in Zeiten von Facebook, Twitter & Co?" bewiesen alle Teilnehmer auf dem Podium ihre Fähigkeit zur sachlichen Analyse und Sprachfertigkeit. Alle Finalisten, die heute in Berlin dabei waren, durften sich als Gewinner fühlen. Denn auf alle warten mehrwöchige Praktika bei verschiedenen Print-, Online- und TV-Medien, z. B. bei der "taz", bei der TV-Produktionsfirma "probono", der TV-Sendung "Galileo" oder "TV Movie". Allen Endrundenteilnehmern bietet sich hier die Chance, das Berufsfeld Journalist für sich auszuloten. Simon Oberbichler hat das Privileg, als Erster aus allen Praktikumsplätzen frei wählen zu können. Mit jährlich knapp 2500 Teilnehmern überzeugen die Duden Open seit vielen Jahren mit glänzenden Anmeldezahlen. Gemeinsam mit seinen Partnern suchte der Dudenverlag immer ab Anfang September talentierte Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten bis 21 Jahre. In insgesamt drei Ausscheidungsrunden wird das Allgemeinwissen der Teilnehmer getestet und Schreib- und Recherchetalent durch eine hochrangige Journalistenjury bewertet. Die Süddeutsche Zeitung hob die Duden Open im Rahmen einer Untersuchung von Schülerwettbewerben als besonders empfehlenswert hervor. Am 1. September 2013 starten die nächsten Duden Open. Mehr Infos schon jetzt unter www.duden-open.de. http://bildungsklick.de/pm/88092/rechtschreibung-ist-sexy/ |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Kiel |
Dieser Beitrag wurde am 08.11.2013 um 21.05 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#10501 Frankfurter Rundschau, 7. November 2013 Bewerbungen mit Fehlern fallen raus Rechtschreibfehler, fehlende Informationen oder abgeschriebene Formulierungen: Mangelhafte Bewerbungen wandern bei den meisten Personalern direkt in den Müll. Wer sorgfältig vorgeht, hat höhere Erfolgschancen. Ein Rechtschreibfehler in einer Bewerbung - das ist für jeden zweiten Personaler (52 Prozent) ein K.o.-Kriterium. Sie sortieren den Jobsuchenden sofort aus. Das zeigt eine Umfrage unter Personalern des Marktforschungsinstituts Harris Interactive. Auch ein Fehler: Jobsuchende nehmen in ihrer Bewerbung keinen Bezug auf die ausgeschriebene Stelle und das suchende Unternehmen. Solche Bewerbungen wirft mehr als jeder Dritte (39 Prozent) sofort weg. Auch keine gute Idee: Statt sich selbst zu überlegen, was Bewerber an einer Stelle interessiert, die Formulierungen der Stellenanzeige ins Anschreiben zu kopieren. Jeder Vierte (24 Prozent) sortiert solche Bewerbungen sofort aus. Für die Umfrage wurden im Auftrag des Jobportals Careerbuilder 400 Personaler befragt. (dpa/tmn) (www.fr-online.de) |
| nach oben | |
|
Jan-Martin Wagner Kiel |
Dieser Beitrag wurde am 13.11.2013 um 20.46 Uhr eingetragen. Adresse: http://www.sprachforschung.org/forum/show_comments.php?topic_id=70#10506 Spiegel online, 12. November 2013 Doktorarbeit direkt nach dem Bachelor: Platz da, ich promoviere Von Hannah König Sie hat noch keinen Master und ist erst 23 Jahre alt, trotzdem promoviert Steffi Krause schon und unterrichtet an der Uni. Viele Hochschulen ermöglichen ihren Studenten die Promotion auf der Überholspur. Aber ist das sinnvoll? Wenn Steffi Krause den Hörsaal betritt, muss sie sich manchmal daran erinnern, wo ihr Platz ist. Nicht zwischen den Studenten - sondern vorn auf dem Podium. Mit 23 Jahren unterrichtet sie an der Universität Passau Studenten, die vor kurzem noch ihre Kommilitonen waren. Denn statt nach dem Bachelor einen Master zu machen, hat sie direkt mit der Promotion begonnen und leitet seitdem als Wissenschaftliche Mitarbeiterin Seminare und Vorlesungen. Steffi Krause macht ihren Doktortitel auf der Überholspur. Deutschlandweit bietet inzwischen etwa die Hälfte der Universitäten den sogenannten "Fast Track" an, hat die Hochschulrektorenkonferenz ermittelt. Im Jahr 2011 wagten laut Statistischem Bundesamt 1300 Studenten, den Master zu überspringen und direkt eine Doktorarbeit zu schreiben. An den meisten Universitäten werden die Promotionsanwärter zunächst in ein einjähriges Vorbereitungsstudium aufgenommen, im Anschluss folgt ein dreijähriges Forschungsstudium. Manchmal läuft die Promotion auch parallel zum Master, dann können sich Studenten nach dem 2. Semester für den Fast Track bewerben. Den Master müssen sie dann trotzdem abschließen. Warum dann überhaupt eine Turbo-Promotion? An der Universität Passau gibt es kein spezielles Programm. Krause konnte deshalb direkt mit der Doktorarbeit beginnen - ohne einen einzigen Masterkurs besucht zu haben. Offiziell musste sie nur einen Bachelor-Schnitt von 1,3 oder besser nachweisen, vor allem aber musste sie ihren Doktorvater überzeugen. Denn die Zulassung zur Direktpromotion ist "grundsätzlich immer eine Einzelfallentscheidung", wie es in einer Stellungnahme der Hochschulrektorenkonferenz heißt. Krauses Betreuer Hans Krah, Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft, drückt es so aus: "Entscheidend ist, ob man dem Dozenten begreiflich machen kann, dass man geeignet ist." Die Note allein sei nicht aussagekräftig. Von Anfang an fiel die Studentin Krause ihm und seinen Kollegen in Vorlesungen und Seminaren auf, interessiert sei sie gewesen und sehr engagiert. "Sie wollte nicht einfach nur gut sein", erinnert sich Krah. "Sie wollte immer mehr!" Immer mehr, immer schneller, immer besser. Bachelor-Studenten klagen ohnehin schon über Stress, warum dann überhaupt eine Turbo-Promotion? Zumal fast alle Universitäten die grundständige Promotion ganz ohne vorherigen Abschluss abgeschafft haben. Warum nicht erst mal möglichst viel lernen, reifen, Erfahrungen sammeln, Spaß haben? Das fragte sich auch Steffi Krause. Denn ihre steile Uni-Karriere hat sie so nicht geplant. Anfangs, sagt sie, sei sie nicht mal sicher gewesen, ob Studieren das Richtige für sie ist. Sie ist in Berlin geboren, im Stadtteil Marzahn aufgewachsen, die Familie zog mehrfach um, Steffi Krause musste sich oft neu eingewöhnen. In der 12. Klasse habe sie die Schule sogar abbrechen wollen, um eine Ausbildung zur Eventmanagerin zu machen, erinnert sie sich. Was genau sie damals umstimmte, wisse sie selbst nicht mehr. "Ich wollte unbedingt in die Wissenschaft" Zwar habe sie Angst gehabt vor den "brotlosen Geisteswissenschaften", trotzdem bewarb sie sich auf den Bachelor "Sprache und Text" im bayerischen Passau. Schon ab dem dritten Semester arbeitete sie am Lehrstuhl für Allgemeine Pädagogik als wissenschaftliche Hilfskraft. Nebenbei organisierte sie unter dem Motto "Wir machen es selbst" eine Ringvorlesung von Studenten für Studenten. "Damit war es endgültig um mich geschehen", sagt Steffi Krause. "Ich wollte unbedingt in die Wissenschaft." Die Chance auf den Fast Track kam plötzlich: Kurz nach ihrem Bachelorabschluss wurde an der Uni eine Stelle als Wissenschaftlicher Mitarbeiter frei. Sie hätte schon gern den Master gemacht, erzählt Krause - "auch weil ich dachte, dass ich vielleicht noch nicht gut genug bin". Andererseits wusste sie auch: So eine Chance bekommt man selten. Sie überzeugte ihren Doktorvater von der Idee, den Master zu überspringen, und bewarb sich auf die Stelle. Und plötzlich musste sie jene Kommilitonen benoten, die mit ihr den Bachelor angefangen hatten - keine einfache Situation für die damals 22-Jährige. Selbst heute, ein Jahr später, zweifelt sie manchmal noch: "Bin ich genug vorbereitet, kann ich alle Fragen beantworten, mögen mich die Studierenden - die Nervosität vor dem Semester oder bei Vorträgen geht nie so ganz weg", sagt Steffi Krause. Doch der Respekt kam schneller als erwartet: Sprüche oder Pöbeleien habe sie sich nie anhören müssen. Das könnte auch an ihrer einnehmenden Art liegen. Die junge Frau wirkt älter und reifer, als sie eigentlich ist. Sie spricht mit fester, ruhiger Stimme, lacht viel und laut. Sie ist selbstbewusst und spricht zugleich über ihre Laufbahn, als wäre sie nichts Besonderes. Kommt am Ende überhaupt eine Arbeit dabei raus? Verändert habe sich in ihrem ersten Jahr als Dozentin vor allem ihr Party-Verhalten: "Ich bin auf jeden Fall spießiger geworden", sagt Steffi Krause. Sie könne jetzt nun mal nicht mehr so lange feiern wie der Student in der letzten Reihe. Dass sie wegen ihrer schnellen Promotion etwas verpassen könnte, glaubt sie nicht: Sie habe in den ersten Semestern schon ausgiebig gefeiert, jetzt mache ihr die Arbeit Spaß. Die größte Schwierigkeit als junge Doktorandin sei es eher, sich jeden Tag aufs Neue selbst zu strukturieren, zu motivieren. Daran scheitern viele - selbst wenn sie mehr Erfahrung haben als Krause. Auch deshalb steht ihr Doktorvater der Promotion nach dem Bachelor eher skeptisch gegenüber. Viel wichtiger als gute Noten sind seiner Meinung nach Durchhaltevermögen und Zeitmanagement. "Wie soll man diese Fähigkeiten in nur sechs Semestern erworben haben?", fragt Krah. Die Qualität der Arbeiten müsse nicht unbedingt schlechter sein. "Die Frage ist eher, ob am Ende überhaupt eine Arbeit dabei rauskommt", sagt der Professor. Nicht alle Studenten seien für die Überholspur geeignet - denn manche Dinge lerne man eben erst mit der Zeit. (www.spiegel.de/unispiegel) |
| nach oben | |
Zurück zur Themenübersicht | nach oben | |